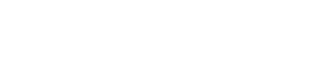
Texte von Dr. Klaus Raab
Ab und an schreibe ich kurze Geschichten
Fingerübungen sozusagen für den Geist.
Meine Mutter löste Kreuzworträtsel. Sie war erfolgreich damit und zumindest bis zu ihrem 93. Geburtstag fit. Ob das ohne Kreuzworträtsel auch so gewesen wäre, kann keiner beantworten. Also schreibe ich. Kurze Geschichten. Für meine Freunde. Hauptsächlich für mich.
Früher habe ich versucht zu zeichnen und zu malen, hatte auch Zeichenstunden bei Prof. Bammes in Freital. Neben mir saß Wolfgang Petrowsky, heute ein anerkannter Maler. Ich sollte nach der Natur zeichnen. Meine Distel war nicht scharf genug. „Das muss aggressiver rüberkommen!“ meinte Bammes. Mir lag das nicht so.
Petrowsky haben wir alle bewundert, er konnte nackte Frauen malen. Aktfotos waren damals schwer zu besorgen. Und Indianer zu Karl-May-Büchern. Indianerfilme kamen auch erst später mit dem DEFA-Indianer Goiko MIticz.
Zu Studentenzeiten hatte ich mich mit meinem Chemiedozenten einem Pankower Malkreis angeschlossen. Da griff ich tief in die Farbtöpfe. Ein überfahrener Hund vor dem Kloster Sagorsk in Russland, erlebt anlässlich einer Seminarreise, war zu plastisch. War nicht korrekt.
Danach habe ich fotografiert, in schwarz/weiß. Format 6×6, Rollfilm selbst in der Dose entwickelt. Das brachte mir während meiner Wehrdienstzeit die Herrschaft über das Fotolabor der Kompanie. Ausgleich für das obligatorische Fugenschruppen mit der Zahnbürste, weil ich Abitur hatte. Mein Stern sank, nachdem ich bei einer Transportübung nur unscharfe Bilder abgeliefert hatte. Die Leidenschaft ist mir geblieben.
Nach der Wende bin ich Wolfgang Petrowsky anlässlich einer Ausstellung in Hannover wiederbegegnet. Er hatte im Rahmen eines gesamtdeutschen Projektes zur deutschen Fahne ein Exponat abgeliefert: „Zeit eingeweckt“, die DDR-Fahne in Weckgläsern in einer Kiste. Zum Höhenausgleich waren ein paar Bücher drin. Ein Titel fiel mir auf: „Prof. Bammes: Der nackte Mensch“.
Ich bin Flüchtling. Mit Ausweis- ohne Leistungsanspruch
Den Ausweis habe ich 1983 bekommen, nachdem ich aus der DDR rübergemacht hatte. Nicht aus eigenem Recht, sondern weil meine Eltern aus dem Sudetenland seinerzeit umgesiedelt wurden.
Doch der Reihe nach.
Ich bin ein 48’er. Jahrgang. Ich erinnere mich an unsere Dachgeschoßwohnung, wo ich mir mit meiner Großmutter ein Zimmer teilte. Heizung war nicht, aber wunderschöne Eiskristalle an der schrägen Decke, weil unsere Atemluft im Winter gefror.
Meine Mutter wurde 1945 in der Tschechoslowakei interniert und musste für die neuen Herrschaften kochen. Dann wurde sie mit den anderen Deutschen zu Fuß über das Riesengebirge geleitet, um schließlich in Landshut zu landen. Ihre Schilderungen des Marsches habe ich nie an mich herangelassen. Die Großmutter und zwei ihrer Töchter hatte es nach Sachsen verschlagen. Über das Rote Kreuz fand sich die Familie wieder. Die Großmutter bettelte, meine Mutter möge doch nach Sachsen kommen. Damit war mein zukünftiges Schicksal vorerst besiegelt.
Vater kam 1946 aus russischer Kriegsgefangenschaft ein wenig entkräftet. Er fand dann Arbeit in einer Glasfabrik, wo er tagsüber Fotolinsen glühte und presste und nachts die Öfen heizte. Den Job durfte er aber nur behalten, wenn er in die SED eintreten würde. Was macht man nicht alles aus Liebe.
Die Schwerarbeiter- Lebensmittelkarte bekam er, weil er am Wochenende auf Abbruch arbeitete, Das hieß so, weil das örtliche Stahlwerk zur Begleichung der Reparationskosten abgerissen und auf einen Schrottplatz hinter die polnisch- russische Grenze gebracht werden musste. Auf diese Weise bekam ich sonntags Fleisch zu Gesicht. Mutter und ich durften mal naschen.
Seinerzeit waren die Winter kalt. Mein Cousin, sieben Jahre älter als ich und ich als fünfjähriger Knirps mussten Kohle organisieren, wie man das Klauen damals nannte. Er stand Schmiere, und ich hatte auf die Kohlewaggons am nahen Bahnhof zu klettern und mit einer kleinen Schaufel eine mitgebrachte Tasche zu füllen. Nach Heimkehr stellten wir fest, dass ich statt Kohlen nur schwarzen Schnee erbeutet hatte. Die Ohrfeigen meiner Mutter spüre ich noch heute.
Mit der Schule machte ich früh Bekanntschaft. Ich muss wohl fünf Jahre alt gewesen sein, als wir uns entschlossen, das Spalierobst an der Schulwand zu ernten. Mein Cousin stand wieder Schmiere, bemerkte aber den Musiklehrer nicht. Der nahm mich mit. Ich musste nachsitzen. Mein Einwand, ich ginge ja noch gar nicht zur Schule, führte zur Strafverschärfung.
Die Grundschule überstand ich weitgehend unbeschädigt, da meine Statur genügend Abschreckungspotential bot.
Dann kam die Erweiterte Oberschule, die mit dem Abitur endete. Das wäre aber fast schief- gegangen. Mein Gerechtigkeitssinn war irgendwann nicht zu zügeln. Wir sollten kurz vor dem Abitur an einem Samstag für den Weltfrieden demonstrieren. Da beschloss ich, zum Streik aufzurufen. Das war natürlich ein Sakrileg. Ich wurde nicht von der Schule suspendiert, machte aber erste Bekanntschaft mit dem System. Meine Bewerbung zum Medizinstudium wurde sehr zögerlich bearbeitet. Nach meiner Aufnahmeprüfung in Jena erhielt ich den Bescheid:
„wegen ungewöhnlicher Differenzen in Ihren gezeigten Leistungen und der Beurteilung durch die entsendenden Gremien werden Sie zu einer erneuten Prüfung durch die Erweiterte Zulassungskommission eingeladen.“
An meinem Zensurendurchschnitt konnte es nicht gelegen haben, der war in Ordnung. Wie ich später erfuhr, hatte mein Schuldirektor eine nicht eben freundliche Beurteilung bewirkt.
Neben dem Abitur mussten wir noch eine Facharbeiterausbildung absolvieren. Ich wurde Dreher und dachte mir, damit kannst Du auch eine Familie ernähren. Als Arzt hätte ich auch nicht viel mehr verdient. Meine Aufregung über die erneute Prüfung hielt sich also in Grenzen.
Ich reiste an in Schlips und Kragen, wurde recht frostig empfangen und saß am runden Tisch mit etwa 20 Prüfern. Ich erwartete Fachfragen und bekam sie: „Warum sind die Gullideckel rund?“ Durchgefallen bin ich nicht, musste aber noch ein einjähriges Krankenhauspraktikum machen.
Viel möchte ich davon nicht erzählen. Der Chefarzt wohnte in einer Villa gegenüber dem Krankenhaus und freute sich über seine prächtigen Rosen. Ich war in die Stationsschwester vernarrt und rasierte den Strauch. Ihre Augen werde ich nicht vergessen. Am nächsten Morgen musste ich in den Op mit Fachbuch. Der Chefarzt operierte, und ich musste aus dem Lehrbuch vorlesen. Er richtete sich danach. Meine Vorlesung war wohl gut genug, Der Patient hat überlebt. Während der Operation brabbelte der Chefarzt aber immer wieder über seine Rosen. Da sei ein Verbrecher dran gewesen, den wolle er gerne kriegen.
Dann kam ich zum Militär nach Krugau, ein Nest im Spreewald. Fliegertechnisches Lager. Wachdienst 24 Stunden. Ich hatte ein kleines Radio, das ich mir beim ‚Wache gehen’ zwischen Kragen und Stahlhelm klemmte, und hörte über den Prager Aufstand. Ein paar Tage später lagen wir im Schützengraben und mussten mit scharfen Handgranaten üben. Wir fuhren in Mannschaftswagen über die Grenze. Als wir ankamen, war Gottseidank alles vorbei.
Trotzdem mussten wir uns freiwillig verpflichten, bis zur Beendigung des Konfliktes Soldat zu bleiben.
Gut einen Monat verspätet wurde ich entlassen. Wohnheimplätze oder Studentenwohnungen waren nicht mehr zu bekommen.
Die erste Nacht verbrachte ich auf den Bänken des Berliner Ostbahnhofes. Immer wenn ich gerade eingeschlafen war, weckte mich eine Streife.
Den ersten Tag des Studiums erlebte ich in der Anatomie, Im Gedächtnis bleiben mir die Studentinnen, die bis zum Ellenbogengelenk in den Präparaten unterwegs waren.
Ein Pathologieassistent wurde mir als Verantwortlicher für die Grenzsicherung in der Charité benannt. Er kümmerte sich um mich. Wir Studenten mussten als Liebespaar getarnt an der Mauer spazieren gehen, um mögliche Grenzverletzer frühzeitig festzustellen. Er stellte die Dienstpläne auf. Auf der Runde mussten wir an mehreren Kneipen vorbei. Mit den Wirten konnten wir uns schnell einigen, wo man bei Regen unterkommen konnte. Es regnete fast immer.
Über eine Anatomieassistentin kam ich in einem zu renovierenden Haus in Hohen Neuendorf unter, das ich vor dem Einfrieren bewahren sollte. Mein Problem war, dass mir als Student keine Kohlenkarte zustand. Aber im Kohleorganisieren hatte ich ja Übung. Ich stiegt also bei Nacht über den Zaun des örtlichen Kohlehändlers. Mein Pech war nur, dass der Winter 1968/69 extrem schneereich und kalt war. Ich kam mit dem Kohleklauen nicht hinterher. Ein- und Ausgang zum Haus war ein Dachfenster, die Haustür war wegen der Schneemassen nicht zu öffnen. Die Kohlen reichten nur zum Heizen des Bades. Ich musste mich zum Lernen ins Bett legen und heizte mit einer Infrarotlampe im Intervall- mal die Hände mit Buch, mal die Nase. Letztlich wurde ich mit Schimpf und Schande aus dem Haus gejagt, weil die Toilette trotzdem eingefroren war. Gottseidank lernte ich einen Blumenzüchter aus der „LPG 1. Mai“ kennen. Für Schnittblumen konnte man alles bekommen, auch Toilettenbecken. Damit war mein Leben gerettet- In Träumen sah ich schon die Geldeintreiber der Russenmafia an meinem Bett.
Ich war im „Ausländerseminar“ gelandet mit Österreichern, Sachsen und Afrikanern, u.a. der Ehefrau des kongolesischen Botschafters. Emily war faul wie die Sünde, konnte aber gut kochen. Sie soll dann auch Ärztin geworden sein. Im Gegensatz zu den meisten von uns hatte sie eine komfortable Wohnung. So trafen wir uns in der Lerngruppe gerne bei ihr. Ich lernte Maniok zu Klößen zu formen und in die Soße zu tunken. Wenn man die Faust schloss, sollte die Flüssigkeit zwischen den Fingern ablaufen. In meinem Seminar war auch der Sohn eines Ministers. Der konnte eine Menge organisieren. So z.B. einen Flug zum 100. Geburtstag von Lenin für unser Seminar nach Moskau im April 1970. Wir tagten im Hotel Ukraina, tranken russischen Champagner und wurden danach aufgefordert, die entstandene Unordnung mit einem Gastgeschenk auszugleichen.
Im gleichen Jahr lernte ich die spätere Mutter meines Sohnes kennen, die ein paar Tage später mit Manfred Krug im Bett lag- als seine Filmpartnerin. Es folgte eine aufregende Zeit zwischen Hörsaal, Theater und Schreibmaschine. Wir besorgten uns die Liedertexte von Biermann und schrieben sie auf klapprigen Schreibmaschinen mit möglichst vielen Durchschlägen ab. Mein seinerzeitiger Oberarzt und Mentor war mit der Schauspielerin Barbara Dittus verheiratet, die eine Resolution gegen die Ausbürgerung von Biermann unterschrieben hatte. Er lag nach eigenen Worten bei der Parteisekretärin der Charité auf den Knien, um zu beteuern, dass er davon nichts gewusst habe. Er muss sehr glaubwürdig erschienen sein. Seine Karriere wurde nicht beeinträchtigt. Bei ihm habe ich später meine Doktorarbeit geschrieben, die Teil seiner Habilitationsschrift wurde.
Und dann wollte ich mich emanzipieren. Ich wollte Ultraschall für die Radiologie nutzen. Zu der Zeit hatten lediglich Gynäkologen entsprechende Geräte. Ich setzte also die Patienten in meinen Trabant und fuhr mit ihnen zur Frauenklinik. Das blieb nicht lange geheim.
Plötzlich wollten auch die Internisten den Ultraschall für sich haben. Ursprünglich war ja die Radiologie aus der Inneren Medizin entsprungen. Sie sollte nun mit Macht wieder eingefangen werden. Die Versuche konnten wegen der Strahlenschutzgesetze abgeblockt werden. Für den Umgang mit Röntgenstrahlen waren Qualifikationsnachweise erforderlich, die mehrjährige Ausbildung erforderten. Ultraschallwellen sind aber keine Röntgenstrahlen. Also witterten viele Fachgebiete Morgenluft. Hier half nur eine gute Ausbildung. Ich hatte das Glück, bei dem Ordinarius der Frauenklinik an der Universität in Wien lernen zu können, der auch die Ultraschalluntersuchungen für Internisten und Radiologen durchführte.
Schließlich gelang es mir, den Gynäkologen ein gebrauchtes Ultraschallgerät abzuluchsen. Und ich organisierte Ausbildungskurse für Radiologen, Internisten und sonstige Interessierte. Daraus entstand dann mein „Atlas der Allgemeinen Ultraschalltomographie“ und die Idee, durch quantitative Analyse des Ultraschallbildes bessere Diagnosen zu ermöglichen. Ich baute eine Abteilung Ultraschalldiagnostik an der Berliner Charité auf. Die Ergebnisse der Patientenuntersuchungen mussten natürlich überprüft werden. Dazu wurden Gewebeproben von primär untersuchten Patienten nach Operationen untersucht und mit den feingeweblichen mikroskopischen Untersuchungen abgeglichen. Das war mit verschiedensten Partnern zu koordinieren. Wenn ich Erfolg hätte, wollten natürlich viele partizipieren.
Eines Tages bekam ich den Auftrag, das Projekt als „Staatsplanthema“ einzureichen. Die DDR war damals interessiert, international Aufsehen zu erregen. Es wurden Forschungskapazitäten konzentriert und sogenannte „Staatsplanthemen“ initiiert. Ich hatte Glück. Eines Tages erhielt ich eine Einladung in einem Gästehaus des Ministerrates, mein Thema vor dem Rat für Medizinische Wissenschaften der DDR zu verteidigen. Die Wegbeschreibung war abenteuerlich. An der Autobahnraststätte Eberswalde sollte ich dem Feuerwehrfluchtweg folgen und würde irgendwann an einem Hotelkomplex ankommen. Das Gebäude hat mich schon beeindruckt, noch mehr allerdings meine Prüfer.
Wieder einmal saß ich in einem Kreis, diesmal waren es die Ordinarien der Universitäten. Erneut wurde ich examiniert. Alle hatten eigene Kandidaten ins Rennen geschickt. Fünf sollten ausgesiebt werden. Es gab im Land sieben Universitäten. Keiner wollte leer ausgehen. Die Professoren kämpften mit Haken und Ösen und setzten auch ihre Biografie als Antifaschist und ins Exil vertriebener Jude ein. Mir blieb nur, mich auf die wissenschaftliche Schiene zu konzentrieren und nicht beirren zu lassen. Ein aus Amerika zurückgeholter Professor für Biochemie fragte, ob ich Doppelblindversuche durchgeführt hätte. Das Prinzip war nicht anwendbar, da meine Probanden nicht lebendig waren. Aber der Versuch, mich aufs Glatteis zu führen war ja nicht strafbar. Ich hatte Glück, dass die Ordinarien selber anwesend waren und nicht ihre Oberärzte, die mehr gewusst hätten.
Die bestandene Verteidigung bedeutete für mich, Devisen für Forschungsinvestitionen und Reisemöglichkeiten in das „Nichtsozialistische Ausland“ zur Verfügung zu haben. Einige Institute versuchten mich anzubaggern. Aber ich wollte nicht weg aus Berlin. Jedenfalls damals nicht.
Prof. Thijssen aus Nijmegen in Holland war an einer Zusammenarbeit sehr interessiert. Er war Physiker in der dortigen ophthalmologischen Universitätsklinik und forschte an einem vergleichbaren Projekt an der Prostata mit allerdings anderem theoretischen Ansatz. Viele wollten damals in den Körper hineinschauen, ohne ihn aufschneiden zu müssen. Dazu wurden Computertomographie, Kernspintomographie und eben auch Ultraschalltomographie weiterentwickelt. Es folgte eine Zeit fruchtbarer Kooperation.
Um meine Sicherheit musste ich mir keine Sorgen machen. Das wurde vom Ministerium für Staatssicherheit erledigt. In meiner Stasiakte gibt es aufregende Einträge.
„Peter (10 Jahre alt im Hotel in Rostock): „Hallo Oma, wie geht es Dir? Oma (meine Mutter in Freital): „Hallo Peter, wie geht es Dir ?.“
Gespräch aufgezeichnet am 17.2.1984 von Major Lehmann in Berlin.
1982 war Internationaler Kongress für Biomedizinische Technik in Hamburg. Meiner Delegation, die vom Gesundheitsministerium nominiert worden war, gehörte selbstredend ein Mitarbeiter der Firma Horch und Lausche an. Dem begegnete ich auf der Zugfahrt im Gang . Wir hatten beide eine Flasche Wernesgrüner Pils in der Hand. Ich hatte es mir von meiner „Devisenreserve“ gekauft, die ein Notgroschen sein sollte. Da der Kellner mich belehrte, dass diese Biersorte nur an Devisenausländer abgegeben würde, hatte ich meine Reserve halbiert.
Irgendwie muss diese gemeinsame Biersorte mein Gegenüber motiviert haben, mir ein nettes Wort zu gönnen. Er meinte jedenfalls, dass dies wohl meine letzte Reise ins Nichtsozialistische Ausland gewesen sei. Geantwortet habe ich ihm nicht. Mit meinen holländischen Forschungspartnern haben wir dann eine Vortragsreise durch die Niederlande organisiert, die letztlich in Hamburg endete. Meine Forschungsergebnisse habe ich zurückgelassen. Das hat das Regime nicht geglaubt, weil meine früheren Mitarbeiter sich nicht intensiv mit den Ergebnissen beschäftigen wollten und lieber erklärten, es sei nichts mehr da.
Mein Problem war, dass ich keinerlei Dokumente, wie Approbation oder Facharzturkunde dabei haben durfte. Ich hatte zwar vorher des Nachts die Dokumente abgelichtet und die Filme in der Dose entwickelt. Die Negative versteckte ich in Buchrücken und in Postkarten mit Metallprägemotiven, die ich vor meinem Abflug am Flughafen in die Post gab. Die Sendungen kamen alle an. Nur hat eine Kopie ohne Original keine Beweiskraft.
Ich erschien dann mit einer Freundin der Familie im Amt in Elmshorn und erhielt den Bescheid, als Krankenpfleger Arbeitslosengeld bekommen zu können. Ohne Vorlage der Approbationsurkunde im Original könne ich jedoch als Arzt nicht arbeiten. Außerdem sei Voraussetzung zur Erteilung der Approbation ein Ariernachweis. Der erforderte jedoch die Beibringung der Geburtsurkunde des Großvaters väterlicherseits. Mein Großvater war in Schlesien geboren. Das half. Auf eine Anfrage an die Botschaft der Tschechoslowakei erhielt ich eine Kopie aus der Taufmatrikel. Das Original der Approbation musste dann unter der Soutane eines Pfarrers die Grenze überqueren.
Frau und Sohn warteten dann etwa zweieinhalb Jahre auf die Familienzusammenführung. Letztlich soll eine Vorsprache von mir bei Franz Joseph Strauß den Ausschlag gegeben haben.
Meine erste Station im Westen war Schleswig. Nach Berlin mit über einer Million Einwohner waren 38 000 schon ein Schock. Ich wurde Oberarzt im Kreiskrankenhaus und dachte ein bisschen an die Universität. Meine Vorsprache bei der zuständigen Uni in Kiel brachte mich wieder auf den Boden. Der Chef der Radiologie erklärte mich mit 35 Jahren schlicht als zu alt. Ich würde die Hierarchie bei den Assistenten durcheinander bringen, würde als Habilitant anderen die Karrierechancen wegnehmen. Ich könnte aber versuchen, bei den grünen Chaoten in Göttingen unterzukommen. Darauf habe ich dann verzichtet. Ich war ja alles schon gewesen. Universitätsdozent, Vorsitzender einer medizinischen Fachgesellschaft. Nun wollte ich als radiologischer Handwerker mein Geld verdienen.
Ich habe mir dann noch eine Ausbildungsstelle in Computertomografie in Detmold besorgt und mich letztlich in Wilhelmshaven im katholischen St. Willehad- Hospital als Chefarzt beworben und wurde als HEIDE genommen. Die Randbedingungen waren nicht eben einfach. Scheidung wäre ein Kündigungsgrund gewesen, ebenso das Leben in ungesetzlicher Ehe. Ich mußte für drei Sprösslinge sorgen. Damit wäre ich zu disziplinieren gewesen.
Dennoch haben mich die Kollegen zum Ärztlichen Direktor gewählt, den ich mit Unterbrechungen 20 Jahre gegeben habe.
Seit fünf Jahren bin ich glücklich verheiratet und habe zwei Kinder dazu bekommen.
Ich finde, dass ich meine berufliche Prüfung bestanden habe und nun noch ein bisschen an der Kür im Ambulanten Hospiz und im Roten Kreuz nachbessern kann.
Brief an einen Mitschüler, den ich 50 Jahre nicht gesehen hatte
Hallo Rainer,
das 50 jährige Abitur beschäftigt mich immer noch. Die doch sehr verschiedenen Biografien unserer Klassenkameraden könnten Bücher füllen. Ich hatte den Eindruck, dass bei einer Reihe von früheren Mitschülern Frust verblieben ist wegen der Wende. Das ist sicher verständlich, weil manche Lebensentwürfe umgekrempelt wurden.
Weshalb ich den Brief heute schreibe, ist die Meldung vom Tod von Margot Honecker. Besser die Reaktion der Medien darauf.
Ich hatte ja in Berlin Medizin studiert und erlebte die Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1973 hautnahe. 8 Millionen Menschen sollen damals nach Berlin gekommen sein. Unser Semester wurde in Schulen kaserniert, und wir mussten Kinder von vermuteten Dissidenten von zu Hause abholen und in Heime für die Zeit der Weltfestspiele verbringen. Die Eltern wurden prophylaktisch festgesetzt. Der während der Festspiele verstorbene Walter Ulbricht wurde tiefgekühlt und erst nach Abschluss der Veranstaltung zur Beerdigung freigegeben.
Ich konnte mich mit dem Umgang der Regierung mit dem Volk auf Dauer nicht identifizieren und fand einen Weg, dem zu entfliehen.
Der Anfang in der neuen Welt war holprig. Meine angedachte Karriere als Wissenschaftler ließ sich nicht mehr realisieren, weil ich mit 36 Jahren zu alt war.
Letztlich landete ich in einem katholischen Krankenhaus, das unmittelbar nach meiner Pensionierung einer feindlichen Übernahme zum Opfer fiel.
Anlässlich dessen wurde ich aufgefordert, einen Beitrag für die örtliche Presse zu schreiben:
Der Geist eines katholischen Krankenhauses
Meine erste Begegnung mit einer Ordensschwester fand 1986 statt.
Ich hatte mich auf die Stelle des Chefarztes der Röntgenabteilung beworben und wurde im Dezember 1986 zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Eigentlich hatte ich mich schon für eine Niederlassung in eigener Praxis in Bielefeld entschieden, nachdem die Klinik lange nichts von sich hören ließ.
Um mir aber später nicht eventuell Vorwürfe zu machen, eine Chance nicht genutzt zu haben, fuhr ich mit Frau und Kind nach Wilhelmshaven. Eine Stadt, die ich erst im Atlas suchen musste.
Zu meiner Überraschung fand das Vorstellungsgespräch in großer Runde mit Verwaltung und Chefärzten statt, entsprechend lange und intensiv. Ich wurde gewählt.
Als ich spät am Abend in der Vorhalle des Hospitals die Familie wiedertraf, waren alle hungrig und kein Restaurant in Sicht.
Das war der Auftritt von Schwester M. Cherubine, der seinerzeitigen Oberin. Sie holte aus ihren unergründlichen Taschen den Generalschlüssel heraus und zauberte in der Küche ein Abendbrot für uns.
Wir waren sofort angenommen und behütet. Ein Gefühl, das mich in meinen 26 Willehad-Jahren nie verlassen hat.
Als ich dann im Februar 1987 meine Chefarztstelle im St.- Willehad- Hospital antrat, erhielt ich ein Geschenk, Schwester M. Ferdinandine, meine „Röntgennonne“. Sie war seit Menschengedenken praktisch Inventar der Abteilung, deckte alle Bereitschaftsdienste ab und „erzog“ die Assistenzärzte des Hauses. Wer nachts eine Röntgenuntersuchung anforderte, musste schon gute Gründe haben, sie zu wecken.
Lange konnte ich sie leider nicht mehr als Röntgenassistentin erleben. Die Augen ließen nach. Aber auf’s Altenteil wollte sie noch nicht. Sie hatte beobachtet, dass ich bei bestimmten Untersuchungen eine Lupenbrille nutzte und bat , sie ausleihen zu dürfen. Das ging ganz gut, und so hat sie uns noch Jahre geholfen, Röntgentüten zu recyclen, indem sie mit Klebestreifen die Namen auf aussortierten Archivtüten überklebte.
Von Schwester Ferdinandine ging eine Fröhlichkeit aus, die uns manche Schwierigkeiten vergessen ließ. Legendär waren unsere gemeinsamen Faschingsfeiern, ich sehe immer noch die Papierrose an ihrer Ordenstracht.
Eine „Röntgennonne“ habe ich nicht wieder bekommen, aber die Fürsorge der übrigen Ordensschwestern sehr wohl genossen. Nicht nur die Patienten erfuhren bedingungslose Zuneigung, auch das Personal konnte sich mit seinen Kümmernissen anlehnen.
Besonders beeindruckt hat mich die Betreuung Sterbender durch die Ordensschwestern. Das hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass ich mich jetzt im ambulanten Hospizdienst engagiere.“
Vor einigen Jahren erwachte mein historisches Interesse, und ich habe Einsicht in meine Stasiakte beantragt. Das waren dicke Ordner. Darunter fand ich Mitschnitte von Gesprächen meines Sohnes mit seiner Oma. Er rief sie aus Rostock an, sie war in Freital. „Hallo Oma, wie geht es Dir?“. Oma: „Mir geht es gut.“ Mehr war da nicht. Diese Banalität war für mich erschreckend.
Mein bester Freund war Informeller Mitarbeiter. Seine Berichte waren nicht sehr appetitlich. Er empfahl, mich beim Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Ich bin ihm nie wieder begegnet.
Frau Honecker hat so manchen Lebensentwurf umgekrempelt. Meinen auch.
Ich habe mein Leben akzeptiert.
Herzliche Grüße
Gestern waren wir in der Kirche Santelmo auf Teneriffa. Eine eindrucksvolle Barockarchitektur. Herrliche Altarkunst. Vor dem Marienaltar suchte ich vergebens Andachtskerzen.
Wenn ich früher in eine Kirche kam, konnte ich eine Andachtskerze kaufen und sie an den anderen anzünden. Beim Duft der Kerzen dachte ich an meine Ahnen. Die Andachtskerzen sind wohl ein Auslaufmodell.
Also warf ich 20 Cent in den Schlitz eines Kastens, und eine flackernde Leuchtdiode zeigte mir, wo früher meine Kerze gesteckt hätte. Eine Zwiesprache mit meinen Altvorderen gelang mir nicht, eher dachte ich an Ablasshandel „Wenn das Geld im Kasten klingt…“ .
Ansonsten ist mir die Kirche in guter Erinnerung geblieben. Eindrucksvolle Barockarchitektur. Herrliche Altarkunst.
Aber keine Andachtskerzen zum Anfassen.
Anja war eine junge Dame von vier Jahren und lebte bei Ihrer Mutter. Wir hatten auch nach unserer Trennung einen guten Kontakt und beschlossen einen Vater/Tochter-Winterurlaub im Harz, um Ski fahren zu lernen. Ich arbeitete damals in Berlin und wollte Anja abholen. Sie hatte aber in der Zwischenzeit der Mut verlassen. Sie wollte nicht mehr mit. Kann man nichts machen.
Ich fuhr zu meinen Eltern, die im gleichen Ort wohnten, um am nächsten Morgen allein zu starten. Ich war schon auf der Autobahn als die Mama anrief, Anja wollte nun doch mit. Natürlich kehrte ich um, musste aber den Rücksitz ausbauen, um das Gepäck unterzubringen.
Ein Urlaubsquartier zu finden war zu dieser Zeit nicht ganz einfach. Da ich den Ortsbürgermeister der Gemeinde behandelt hatte, gelang das. Es war ein einfaches Zimmer im Dachgeschoß. Waschen mussten wir uns in einer Schüssel hinter einem Paravent. Nach der Gutenachtgeschichte verzog ich mich im Mantel in den Wintergarten und las mit Taschenlampe Krimis. Meist nicht lange, dann fielen auch mir mir die Augen zu.
Wir suchten uns die kleinsten Hügel aus. Die waren aber immer noch zu steil. Erst als ich mich bei der „Abfahrt“ auch auf den Hintern setzte, erwachte Anja’s Ehrgeiz, und sie wurde besser als ich.
Ich konnte sie als Siegerin der Mama wieder übergeben.
Ich würde jedem abraten, die Einladung zur Feier des Goldenen Abiturs anzunehmen.
Man altert im Minutentakt bis auf das Doppelte. Ich kann das beurteilen, ich habe das erlebt. Das begann mit der Einladung.
„Zur Feier… laden wir ein und gedenken gleichzeitig derer, die nicht mehr unter uns weilen.“ Ich bin trotzdem hingefahren, obwohl oder weil ich die Leute 50 Jahre nicht gesehen hatte.
Zur Aula im 5. Stock sind alle in den Fahrstuhl gestiegen, nicht nur die im Rollstuhl und die mit Krücken. Beim Sektempfang suchte ich frühere Mitschüler. Zwei erkannte ich, einen an seinem Rundrücken, den er damals schon wegen eines Scheuermanns hatte, den anderen an seinen X- Beinen. Ich wusste also, in welcher Reihe ich Platz zu nehmen hatte.
Die amtierende Direktorin des jetzigen Gymnasiums hielt eine sehr neutrale Rede. Dann trat der Chor der Abiturienten, Leistungskurs Musik, auf. Es war gleichzeitig Teil seiner Abiprüfung. Sie haben alle bestanden. Sie sangen Lieder von Abba und aus Cats und dem Phantom der Oper. Toll. Ich erinnere mich, vor 50 Jahren an gleicher Stelle gesungen zu haben: „Wann wir schreiten seit an seit“ und „Brüder zur Sonne zur Freiheit“. Die Abiturienten sahen alle viel jünger aus als wir damals. Wie sie dann von der Bühne sprangen, beneidenswert.
Einer der Alt-Abiturienten hielt eine launige Ansprache. Behalten habe ich ein Wortspiel über die Wende, die er als Kehre bezeichnete. Ich konnte nicht umhin, ein Selfi von mir zu machen und heimlich in die Runde zu blicken, um meine Mitschüler damit zu vergleichen. Natürlich fand ich mich wesentlich jünger als sie.
Im Anschluss an die Übergabe der Goldenen Abiturzeugnisse ging es zur Besichtigung der früheren Klassenräume. Sie erschienen mir kleiner als seinerzeit, obwohl sie baulich nicht verändert waren. Die Toiletten waren umgebaut, ich habe sie trotzdem am Geruch wiedererkannt.
Nach dem offiziellen Teil trafen wir uns in einer Dorfkneipe, ich habe mir eine Soljanka zum Bier bestellt. Die Gespräche kamen zögerlich in Gang. Ich war der einzige Wessi. Selbstredend musste ich meine Biografie zum besten geben. Über die Gründe meines seinerzeitigen „Rübermachens“ habe ich mich nicht ausgelassen, wurde auch nicht danach gefragt. Dass ich ohne Vorlage meiner Zeugnisse im Westen nicht als Arzt arbeiten konnte und für die erneute Anerkennung meiner deutschen Abstammung eine Geburtsurkunde meines Großvaters väterlicherseits vorlegen musste, fand schon eher Interesse. Dass mein Krankenhaus, in dem ich schließlich gelandet war, zum Zeitpunkt meiner Pensionierung im Rahmen einer feindlichen Übernahme geschlossen wurde, erstickte Diskussionen im Keim.
Zum Schluss kam ein sympathischer älterer Herr auf mich zu, der mir erklärte, dass er sich schon seit 50 Jahren bei mir bedanken wollte, dass ich ihm damals sein Mathe-Abi gerettet hatte, weil ich ihn bei der Prüfung abschreiben ließ.
Wir haben dann Visitenkarten ausgetauscht. Es wird keiner anrufen.
Wer in der Dresdner Gegend aufgewachsen ist, kennt den „Weißen Hirsch“, eine im wahrsten Sinne abgehobene Gegend.
Man kann mit der Standseilbahn nach oben fahren.
Die Gebäude auf der Höhe sind imposant, die Villa Manfred von Ardenne mit Planetarium, die Mutschmann-Villa, von wo aus die Bombardierung Dresdens 1945 gesteuert worden sein soll. Der frühere Club der Intelligenz „Viktor Klemperer“, der frühere Pionierpalast.
Als Pennäler hatte ich einen Musiklehrer, der mir das Trompetenspiel beigebracht und mich für die übrigen Blechblasinstrumente sensibilisiert hat. Er war außerdem Komponist und hatte einen Narren an mir gefressen. Er wollte mir auch das Komponieren beibringen.
Ich habe von ihm viel für das Leben gelernt. Das Komponieren nicht. Aber er hat mich in den Club mitgenommen.
Bei einem der ersten Clubabende wurde über LTI, Lingua terti imperi diskutiert. Ich lernte, dass Sprache viel über eine Gesellschaft aussagt. Viele Sentenzen aus dem 3. Reich fanden sich in der Alltagssprache der DDR wieder. Der Reclam-Band für 50 Pfennige war ab da mein steter Begleiter.
Was ist Zeit? Ein Gegenstandswort, das man anfassen kann? Eher nicht. Von wegen anfassen. Unendlich oft gebrauchtes Wort im Alltag. Eigentlich ein Wort für etwas, was man nicht hat. Wer hat schon Zeit? Kinder kutschieren, Joggen, Sprachkurs in der Volkshochschule. Vielleicht sollte man eine Uhr nach der Zeit fragen.
Auf der Suche nach der Zeit habe ich drei Uhren gefunden. 3 Taschenuhren, eine vom Großvater, eine vom Vater und eine von Anton A..
Der Großvater hatte bei seinem Ausscheiden aus der Buchdruckerei eine Omega- Uhr erhalten. Seinerzeit das typische Abschiedsgeschenk der Firma. Sterlingsilber. Schwer. Bedeutend. Die Familie konnte ermessen, wie wichtig er gewesen war. Das tägliche morgendliche Aufziehen am Frühstückstisch hallte den ganzen Tag nach, noch nachdem sie in der Westentasche verschwunden war.
Die Uhr war ein Wunschobjekt. Man wollte dem Großvater nacheifern. Auch eine bekommen. Als ich sie bekam, war der Großvater tot.
Mein Vater auch. Seine Uhr war eine vergoldete Schweizer mit 15 Steinen. Auch bedeutend, hatte er doch viele Jahren seinen Buckel krumm gemacht, um die Familie durchzubringen. Zu seinem 80. Geburtstag bekam er sie von seiner Elfriede geschenkt. Die hatte sie von ihrer Schwester geerbt. Das sollte der Vater nicht unbedingt wissen. Geliebt hat er die Uhr dennoch und mir vermacht, glücklich, dass er mir etwas hinterlassen konnte.
Und bei den Hinterlassenschaften war da noch die dritte Uhr. Bestimmt ohne materiellen Wert. Es gab da mögliche Berichte über Krieg und Kriegsgefangenschaft. Aber ich kann keinen mehr fragen. Also musste ich sie öffnen. Ich erwartete Zeichen vom Uhrmacher zu durchgeführten Reparaturen. Ich fand die Personalien des Besitzers krakelig eingraviert. Anton A. aus Alfeld.
In Zeiten des Internets müsste es ein leichtes sein zu erfahren, wer der Besitzer war.
Fehlanzeige. In den einschlägigen Heraldikforen, in Verzeichnissen von Grabsteinen, sog. Totenzetteln, den Kirchenbüchern kein Hinweis. Kann ein Mensch so einfach verschwinden?
Also schrieb ich einen örtlichen Uhrmacher und Sachverständigen an. Neben dem Namen war auch noch ein Reparaturzeichen zu erkennen. Die Antwort war zwar bezüglich des Besitzers nicht wirklich weiterführend, beleuchtet aber unsere Zeit.
„Sehr geehrter Herr…
Leider kann ich Ihnen da wenig weiter helfen.
Das Reparaturzeichen ist nicht von mir. Des weiteren sind diese Zeichen wenig aussagekräftig, da jeder „sein“ Zeichen verwendet. Über eine einheitliche Kennzeichnung, die eine Zuordnung z.B. an eine bestimme Handwerkskammer inkl. des Betriebes zulässt, haben sich in der Vergangenheit oft kontroverse Diskussionen in Fachkreisen ergeben, die ergebnislos waren. In den letzten Jahren haben die Aufweichung des Meisterzwangs und die Zulassung auch Externer zum Reparaturmarkt wie auch die rückläufigen Ausbildungszahlen gekoppelt mit einer Stagnation im Uhrmacherhandwerk dazu geführt, dass über derartige Fragen überhaupt nicht mehr gesprochen wird. Die wenigen übrig gebliebenen klassisch ausgebildeten Uhrmacher, die entweder selbständig oder als Angestellter arbeiten, widmen sich da anderen Aufgaben als einer nachvollziehbaren Kennzeichnung von Reparaturmaßnahmen. Sicherlich hat die Digitalisierung da einiges innerhalb der Branche wie z.B. bei den Markenherstellern verändert. Aber ein Zugriff auf eine einheitliche Datenbank, um z.B. Uhren, die gestohlen wurden, leichter zuzuordnen, gibt es bis heute nicht. Jeder Hersteller macht da sein „Ding“. Dass aus der neuen Datenschutzrichtlinie noch ganz andere Komplikationen entstehen, lass ich nun mal unerwähnt.
Früher wurden bei einzelnen Uhrmachern Reparaturbücher geführt. Nur, wenn Sie den Betrieb nicht kennen, nützt Ihnen das wenig.
Reparaturzeichen in Uhren zu kratzen, betrachte ich seit Anbeginn meiner selbständigen Tätigkeit als Sachbeschädigung. Kein Autobesitzer möchte die Reparaturhinweis zu seiner erfolgten Kfz Reparatur unter der Motorhaube finden. Einige Uhrmacher hinterlassen ihre Zeichen sogar ausserhalb der Uhr am Boden oder ähnlich. Ich möchte eine Uhr ohne erkennbare Spuren eines Eingriffes zurückgeben. Optimal ist es, wenn sogar eine Kollege Inside nicht erkennen kann dass die Uhr repariert wurde. Uhren mit x Reparaturvermerken deuten auch auf eine bewegtes Leben oder einen zer- reparierten Zustand hin. Also ich erwerbe so etwas nicht :-)
In meinem Atelier wird mit einem wasserfesten Stift im Gehäuse, nicht unbedingt sichtbar, folgendes notiert 2018 HA 7 bedeutet Im Juli 2018 Vollrevision. Anhand der Buchungsunterlagen könnte man dann z.B. Ihre Adresse ermitteln. Wird das Gehäuse gereinigt, ist die Markierung entfernt.
Den Namen, den Sie nun als Besitzer nennen, kenne ich nicht. Die Weinstrasse ist in Alsfeld eine Strasse, die sich in unmittelbarer Nähe zu der ehemaligen Zechenanlage des Eschweiler Bergwerks „Verein“ befindet, die die grösste Kohlengrube im Aachener Revier war. In dieser Strasse stehen viele kleine Einfamilienhäuser ehemaliger Mitarbeiter ( Kumpel ) der Zeche. Ob da dieser Mann wohnte, lässt sich für mich nicht mehr ermitteln.
Ich bin seit 1989 selbständig und somit im nächsten Jahr 30 Jahre… keiner meiner Vorfahren war Uhrmacher, somit kann ich da auch aus der Historie nichts dazu sagen. Die Uhr selbst ist sicher nichts besonders und auch um 1920-30 hat man schon besseres gefertigt. Also wertvoll ist sicherlich die Geschichte der Uhr, nicht der Wert derselben.“
Heute erhielt ich noch Post von der deutschen Dienststelle:
„Ihre Anfrage vom 26.6.2018 als Anlage urschriftlich zurück. In der alphabetisch und nach Geburtsdaten geordneten Kartei unseres Zentralnachweises ist ein Namensträger „Anton A.“ nicht zu ermitteln.
Die Uhr von Anton A, wird ihr Geheimnis bewahren, auch wenn sie kurzzeitig aus dem Vergessen aufgewacht war.
Dr. Klaus Raab
Unter Mitarbeit von
Hauke Norbert Heffels
Uhrmachermeister & Goldschmied
Alsfeld



Seit geraumer Zeit kümmerte ich mich um die Bankgeschäfte meiner Mutter,
Das war nicht sehr anstrengend. Die Rente kam aufs Konto und ging per Dauerauftrag größtenteils weiter an das Pflegeheim.
Vom Rest kaufte sie Duschgel und Zahnpasta, was der Apotheker lieferte. Übrig blieb gewöhnlich nichts. Die Rechnungen überwies ich prompt.
Dann hatte sie noch ein bisschen Geld in einem alten Portemonnaie, was sie ihren Sparstrumpf nannte. Das waren vom Mund abgesparte Kleinbeträge aus der Zeit vor ihrem Umzug ins Heim.
Eines Tages fand ich auf ihrem Nachttisch den Kostenvoranschlag ihres Zahnarztes in Höhe von mehr als tausend €.
Ich setzte mich umgehend mit dem Zahnarzt in Verbindung, der mir erklärte, dass das schon alles seine Richtigkeit habe.
Ich fragte sie vorsichtig, ob sie den angefordert hätte. “Ja“, sagte sie und zeigte ihr spitzbübisches Lächeln, das ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. „Du weißt ja, dass ich noch den Sparstrumpf habe!“- „Und einen Termin habe ich auch schon“.
Dazu muss man wissen, dass Mutter immer größten Wert auf gepflegte Zähne gelegt hatte und immer predigte: „Wenn Du einen Menschen beurteilen willst, schau Dir seine Zähne an.“
Nun sollte es mit 92 Jahren noch ein Implantat sein.
Eine Zahnlücke ging gar nicht und ein Gebiss zum Rausnehmen auch nicht.
Gegen dieses Lächeln kam ich nicht an.
Also sammelte ich Kleingeld und kleine Scheine zum Füttern des Sparstrumpfes. Beim nächsten Heimbesuch veranstalteten wir einen Kassensturz. Es fehlten 20 €. Ob ich ihr den Rest leihen könne- aber nur leihen?
An jedem Rentenzahltag drückte sie mir 2 € in die Hand.
Sie hat die Schulden abbezahlt und ist mit 96 Jahren eingeschlafen- ohne Zahnlücke.
Wir hatten uns in der Hotelhalle verabredet. Klaus musste noch was für die Firma tun.
Ich wollte ein paar Nachrichten lesen und eine Tasse Tee trinken.
Schräg gegenüber setzte sich eine kapitale Dame an den Tisch, besser- sie nahm den ihr gebührenden Platz ein.
Der Kellner kam gerade noch rechtzeitig, um ihr den Stuhl zurechtzurücken.
Eigentlich hing meine Jacke über dem anderen Stuhl. Das schien sie nicht zu stören.
Irgendetwas hielt mich dann davon ab, meine Jacke in Sicherheit zu bringen. Es war nicht einmal meine Jacke, ich hatte sie gestern mit Klaus vertauscht. Sie war auch nicht nach meinem Geschmack, zu bunt aus Lederstücken zusammengenäht.
Die Szene erinnerte mich an meine Berliner Zeit in den 70er Jahren in Behrens Casino-Tischtelefon, Diskokugel, Damenwahl und Schaumwein.
Schließlich kramte die Dame aus ihrer Louis Vuitton-Tasche ein goldfarbenes Telefon an Kette hervor, legte es vor sich hin und wartete. Kein Klingeln. Ab und an streifte mich ein fragender Blick. Ich konnte ja aber nicht gemeint sein.
Endlich kam Klaus, nahm sich seine Jacke von der Stuhllehne und setzte sich zu mir. Die Verwirrung war komplett, bis schließlich das goldene Telefon klingelte. Wenn keine Kette dran gewesen wäre, hätte es am Boden gelegen.
Bald kam ein reifer Jüngling mit Lederflickenjacke und begrüßte sie mit Handkuss. Eine entfernte Ähnlichkeit mit Heino war vorhanden.
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, verschwanden sie in Richtung Fahrstuhl.
Ich brauchte nicht lange, um Klaus die Jacke auszureden.
Nach meiner unkonventionellen Übersiedlung von Deutschland nach Deutschland musste ich zum Amt. Wahrheitsgemäß gab ich an, dass meine Familie in der DDR verbleiben musste.
Mir wurde erklärt, dass Familienzusammenführungen bekannterweise schwierig seien, es sei denn, ich hätte eine Immobilie in der DDR, die man versilbern könnte. Einschlägige Anwälte seien bekannt, die man diesbezüglich kontaktieren könne. Das traf nicht zu. Als letzte Möglichkeit wurde mir ein Vorsprechen bei Franz Josef Strauß angeraten, der deutsch- deutsche Verwicklungen gegebenenfalls lösen könne.
Also fuhr ich nach München. Die Begegnung verlief geschäftsmäßig ohne Schnörkel. Versprechungen wurden mir keine gemacht. Ich bin wieder nach Schleswig gefahren.
Wer es letztendlich gerichtet hat, weiß ich nicht.
1960. Er sei bei der Fremdenlegion. Sein Zimmer war offen. Ich könne da schlafen.
Meine Großmutter sagte das unsentimental.
Das Zimmer war winzig. Es stand ein Korb im Wege. Das Schloss wirkte seltsam aber verhinderte, dass der Deckel aufsprang. Ein paar Schallplatten lagen obenauf. Beatles, unbekannte tschechische Schlagerstars. Unterhosen, Hemden, ein paar Bücher, Briefe.
Ich legte mich auf den Strohsack und begann zu lesen: Schuhmachergeselle aus Stockerau findet auf der Wanderschaft seine Liebe. Anton nimmt Emilie zur Frau. Gustav wird zur tschechischen Armee einberufen, heiratet schnell noch, bevor er zur deutschen Wehrmacht eingezogen wird.
„Mein liebes Friedele“ steht auf einer Feldpostkarte aus Rußland. Sie haben sich knapp 10 Jahre später in Halle wiedergetroffen.
Großmutters Leben war einfach. Sie hatte vor dem Krieg Junggesellen und Reisende beherbergt. Ihre Auskocherei hielt sie eben am Leben. Die Zimmerherren zahlten, was sie konnten, oft nicht einmal das. Ihr Sohn Gustav war in der Lehre in Chlumec, er gab ihr das, was er nach Kost und Logis übrig hatte. Wenn er das Fahrgeld angespart hatte, besuchte er sie.
Meine Großmutter war eine schwere Frau. Sie sprach wenig. Ihre Worte spülte sie über ihre hängende Unterlippe und erwartete, dass wir sie verstehen. Über ihren letzten Mann weiß ich nur, dass er Buchdrucker war und an Bleivergiftung gestorben ist. Er hat wunderbare Inkunablen hinterlassen.
Beide Töchter hatten Tschechen geheiratet. Deshalb mussten sie 1945 nicht umsiedeln.
Tante Pipi war einem Rennfahrer verfallen. Ab und an gab es Unfälle. Sie stand an der Strecke, er kam irgendwann nicht vorbei. Ihr zerpflücktes Taschentuch ist in der Trophäensammlung konserviert.
Tante Mimi hatte einen Langweiler erwischt. Tischler, seine Sitzbänke sind nicht überliefert.
Großmutters letzter Mieter wollte seinen Namen nicht nennen.
Der Bahndamm trennte uns.
Unsere Familie mit Großmutter, Mutter, Vater und mir und Mutters Schwester mit Mann und Kind.
Die Väter waren eben aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, meiner als Wrack im Salzbergwerk, der Onkel aus Ägypten mit Kakao, Zigaretten und Konserven.
Der Onkel hatte auch ein paar andere Unarten mitgebracht. Er war zum Sadist mutiert. Sein Sohn wurde abends inspiziert. Wenn er einen blauen Fleck aufwies, kriegte er Prügel. Die mitgebrachten Schätze teilte der Onkel mit Niemandem.
Mein Vater bekam einen Job in einer Glasfabrik, in die die Familie zwangseinquartiert worden war. Tagsüber stand er am Glasofen und glühte die Linsen für Fotoapparate vor dem Pressen. Nachts heizte er die Glasöfen, und am Wochenende war er zum Kartoffelstoppeln bei den Bauern in der Umgebung unterwegs.
Dem Onkel wurde eine Kasernenwohnung zugeteilt. Die lag ein paar hundert Meter über dem Bahndamm uns gegenüber. Wir konnten die Fenster sehen.
Willi, mein Cousin, war 7 Jahre älter als ich und das Opfer. Immer wieder stopfte meine Mutter seine Sachen, wenn er sich einen neuen Dreiangel beim Toben eingefangen hatte. Oft kam er zu uns, weil ihn der Vater mit Essensentzug bestraft hatte. Sein Vater war eigentlich begabt. Er konnte zeichnen und malen. Ich besaß einen Kasper, der einen von ihm gemalten Kopf und Glieder aus der Überwurfdecke der Ehebetten der Eltern hatte.
Den Kasper habe ich geliebt. Den Onkel nicht.
Unsere Großmutter stellte abends eine Kerze ins Fenster, damit Willi etwas zum Festhalten hatte.
Willi wurde Elektromaschinenbauer, holte das Abitur nach und wurde Lehrer. Seine Frau ist ihm später mit den beiden Söhnen abhanden gekommen. Sie heiratete den Chef ihres Vaters.
Willi ist seit ein paar Jahren in Thailand verschollen.
Der erste Satz des gleichnamigen Romans von Günter Grass , „Ilsebill salzte nach.“, wurde 2007 zum schönsten ersten Satz eines deutschsprachigen Romans gewählt.
Den hier abgebildeten Fisch habe ich bei einem hiesigen Fischhändler gekauft:
„Ich möchte diesen Goldbutt“. „Das ist kein Goldbutt, das ist eine Scholle!“ war die Antwort des Verkäufers. Eigentlich war es mir egal. Ich wollte einem Fisch auf den Grund gehen. Die zarteste Methode dafür war für mich das Röntgen. Zerstörungsfrei. Und ich hatte das gelernt.
Aber eigentlich wollte ich über den Fisch und das Leben nachgrübeln.
Fische sind und waren in vielen Völkern Zeichen des Lebens, des Glücks und des Heils. In der Antike wurden Fische als Teil der Unterwelt betrachtet. Als Opfergaben für die Götter und die Verstorbenen waren Fische wichtig.
Aber wer hat schon einmal in so einen Fisch hineingeschaut, ohne ihn aufzuschneiden? Hat schon einmal jemand einen Rippenbruch beim Butt diagnostiziert? Die Natur ist voller Wunder. Wir müssen sie nur sehen wollen.
Mein Goldbutt war schon mausetot, als ich ihn von außen und innen betrachtet habe. Und er hatte eine gebrochene Gräte. Aber war er nicht schön? Die rotgoldigen Tüpfel auf der Haut glänzten. Das zarte Skelettsystem besaß eine eigene Ästhetik, wenngleich er diesen Schönheitsfehler hatte, die gebrochene Rippe.
Wir haben ihn dann küchenfertig gemacht und gebraten. Es war ein Genuss.
Denken wir beim Nachsalzen an die Ästhetik des Fischskeletts und an die Einzigartigkeit des Lebewesens und des Lebens. Leben wir jeden Tag bewusst. Es kann immer der schönste sein.
Meine erste Begegnung mit einer Ordensschwester fand 1986 statt.
Ich hatte mich auf die Stelle des Chefarztes der Röntgenabteilung beworben und wurde im Dezember 1986 zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Eigentlich hatte ich mich schon für eine Niederlassung in eigener Praxis in Bielefeld entschieden, nachdem die Klinik lange nichts von sich hören ließ.
Um mir aber später nicht eventuell Vorwürfe zu machen, eine Chance nicht genutzt zu haben, fuhr ich mit Frau und Kind nach Wilhelmshaven. Eine Stadt, die ich erst im Atlas suchen musste.
Zu meiner Überraschung fand das Vorstellungsgespräch in großer Runde mit Verwaltung und Chefärzten statt, entsprechend lange und intensiv. Ich wurde gewählt.
Als ich spät am Abend in der Vorhalle des Hospitals die Familie wiedertraf, waren alle hungrig und kein Restaurant in Sicht.
Das war der Auftritt von Schwester M. Cherubine, der seinerzeitigen Oberin. Sie holte aus ihren unergründlichen Taschen den Generalschlüssel heraus und zauberte in der Küche ein Abendbrot für uns.
Wir waren sofort angenommen und behütet. Ein Gefühl, das mich in meinen 26 Willehad-Jahren nie verlassen hat.
Als ich dann im Februar 1987 meine Chefarztstelle im St.- Willehad- Hospital antrat, erhielt ich ein Geschenk, Schwester M. Ferdinandine, meine „Röntgennonne“. Sie war seit Menschengedenken praktisch Inventar der Abteilung, deckte alle Bereitschaftsdienste ab und „erzog“ die Assistenzärzte des Hauses. Wer nachts eine Röntgenuntersuchung anforderte, musste schon gute Gründe haben, sie zu wecken.
Lange konnte ich sie leider nicht mehr als Röntgenassistentin erleben. Die Augen ließen nach. Aber aufs Altenteil wollte sie noch nicht. Sie hatte beobachtet, dass ich bei bestimmten Untersuchungen eine Lupenbrille nutzte und bat , sie ausleihen zu dürfen. Das ging ganz gut, und so hat sie uns noch Jahre geholfen, Röntgentüten zu recyceln, indem sie mit Klebestreifen die Namen auf aussortierten Archivtüten überklebte.
Von Schwester Ferdinandine ging eine Fröhlichkeit aus, die uns manche Schwierigkeiten vergessen ließ. Legendär waren unsere gemeinsamen Faschingsfeiern, ich sehe immer noch die Papierrose an ihrer Ordenstracht.
Eine „Röntgennonne“ habe ich nicht wieder bekommen, aber die Fürsorge der übrigen Ordensschwestern sehr wohl genossen. Nicht nur die Patienten erfuhren bedingungslose Zuneigung, auch das Personal konnte sich mit seinen Kümmernissen anlehnen.
Besonders beeindruckt hat mich die Betreuung Sterbender durch die Ordensschwestern. Das hat nicht zuletzt dazu beigetragen, dass ich mich jetzt im ambulanten Hospizdienst engagiere.
Als ich 1985 nach Detmold kam, wurde ich zu einer Podiumsdiskussion eingeladen zum Thema „Auswirkungen des Atomunfalls von Tschernobyl auf Deutschland“.
Ich war neu eingeflogener Radiologe aus Schleswig, hatte aber in meiner Vita eine Karriere an der Humboldt- Universität zu Berlin. Mit im Podium saß ein Physiker aus Detmold neben besorgten Lehrern.
Der Physiker nahm mich frontal an, nachdem ich über die natürliche Radioaktivität gesprochen hatte. Er meinte, künstliche Radioaktivität sei ja etwas ganz anderes als natürliche. Ich war sprachlos wie Seehofer nach der Bewertung der jüngsten Wahl in drei Bundesländern. Bereits damals war mir klar, dass gegen Dummheit kein Kraut gewachsen ist. Eine Dame aus dem Publikum warf dem Veranstalter vor, einen Spezialisten eingeladen zu haben, der nicht auf der allgemeinen politischen Meinungslinie war.
Ich hatte argumentiert mit der kosmischen Strahlung, mit der wir uns seit Menschengedenken auseinandersetzen, mit dem radioaktiven Frühstücksei und mit den natürlichen Reparaturmechanismen bei Chromosomenbrüchen.
Nicht, dass es niemand hätte begreifen können. Das Wollen war entscheidend.
Die Geschichte wiederholt sich manchmal. Fukushima als Fanal für besorgte Bürger.
Was war passiert? Das Atomkraftwerk war notabgeschaltet, als es teilüberschwemmt wurde. Kein Mensch kam durch das Atomkraftwerk zu Schaden, durch den Tsunami 23.
Unsere Bundeskanzlerin als Physikerin erkannte sofort ihre Chance, sich politisch zu profilieren und sorgte für die Atomwende. Ohne Rücksicht auf die Folgen für Umwelt oder finanzielle Belastungen der Bürger.
Wer nicht völlig verblendet ist, wird die jüngsten Wahlerfolge für die AfD daraus erklären können.
Wir saßen mit dem Rücken zur Wand in einem Heidenheimer Restaurant.
Auf der Rückreise von unserem Italienurlaub wollten wir ausruhen.
Der Blick schweifte über die Stadt im Tal.
Es war noch Urlaubswetter, als zwei Gäste den Blick einschränkten. Eine schon weißblonde ältere Dame mit Pagenschnitt und ihr dunkelhäutiger Begleiter- sie behend, er ungelenk.
Unser Kellner, ein Bulgare, eilte dann auch zu ihnen. Zuerst präsentierte die Dame dem Ober ein Deckchen, das ihr Begleiter für sie gehäkelt hatte und reklamierte die Blicke als Lob.
Es fiel schwer, sich von dieser Szene loszureißen. Wir versuchten, unseren Urlaub Revue passieren zu lassen. Der Ablenkungsfaktor war jedoch sehr groß. Wir mussten beobachten, wie der dunkelhäutige Mann beim Essen dressiert wurde- Gabel links, Messer rechts und immer kleine Häppchen.
Dann gingen sie. Ich fing noch seinen Blick auf: Die Dressur schien nicht ganz gelungen.
kommt ohne Streit nicht aus.
Das beste Beispiel ist die Gesundheitspolitik. Natürlich muss man sich um den Gesundheitsetat streiten. Der Gesundheitsminister hat einen Etat zur Verfügung, der naturgemäß immer zu niedrig liegt. Denn wenn man den Bürger fragt,“ was ist Dir Deine Gesundheit wert?“, wird man immer hören: „Alles Geld der Welt“. Nur er hat es nicht und will es eigentlich von den anderen haben, den Beitragszahlern seiner Versicherung.
Das ist schon einen Streit wert.
Nun gibt es aber weitere Streitpunkte. Die Wünsche und Befindlichkeiten der anderen Akteure, der Ärzte, der Verwaltungen und nicht zuletzt der Politik. Und es geht um nicht unbeträchtliche Summen, um Eitelkeiten und um politische Macht. Diese Konflikte existieren objektiv und sind auch mit gutem Willen nicht aus der Welt zu schaffen.
Es wird immer einen Geschäftsführer geben, der Ziele hat. Seine persönliche Vision von seinem Geschäft mit möglichst hohen schwarzen Zahlen, von einem möglichst hohen Gehalt, von Ansehen und Macht. Und er wird immer versuchen, sich nicht zu nahe mit den täglichen Problemen des Betriebs beschäftigen zu müssen. Er wird immer versuchen, betriebswirtschaftliche Methoden zu implementieren, um den Betrieb zu optimieren und nicht zu sehr medizinethische Themen zu berühren. Er muss kontrolliert werden.
Es wird immer den Arzt geben, der den Widerpart gibt, der möglichst viel vom Etat haben will, um seine Patienten optimal zu versorgen, möglichst viel Personal, um seine Arbeitsbelastung in Grenzen zu halten, und möglichst ein Gehalt zu erzielen, das seine Bedürfnissen und denen seiner Frau entspricht.
Es wird immer den örtlichen Politiker geben, der seinem Klientel mit einer möglichst idealen Gesundheitsversorgung zeigt, dass er eine Daseinsberechtigung hat. Mit erfolgreicher Gesundheitspolitik kann man den Bürger noch am meisten beeindrucken. Gutes Krankenhaus mit fröhlichen Mitarbeitern sind die beste Voraussetzung für eine Wiederwahl.
Wie soll diese Quadratur des Kreises gelingen?
Das geht nur, wenn man einem gepflegten Streit nicht aus dem Wege geht. Wenn man den gesunden Menschenverstand nicht ausschaltet, sich traut zu streiten. Vergessen wir dabei nicht die Presse als Regulativ. Zu oft erlebt man einen vorausschauenden Gehorsam der Presse, „wir wollen doch nicht alles schlecht reden“. Gut reden oder schweigen macht aber alles nur noch schlimmer.
Das kann man wie mit einem Vergrößerungsglas im Wilhelmshavener Milieu beobachten.
Wir haben einen ersten Politiker der Stadt, der sich zutraut, die Gesundheitsversorgung zu managen. Er hat natürlich alle Verwaltungsinstrumente in der Hand, nutzt sie aus und vermittelt den Eindruck, alles im Griff zu haben. Der Bürger durchschaut das System aber nicht im entferntesten. Erst einmal glaubt er, wenngleich er seinen gesunden Menschenverstand einschalten müsste.
Der Politiker sucht sich einen Verwaltungschef, einen, der von ihm abhängig ist. Vielleicht hat er ihm auch noch versprochen, dass seine Partnerin hier eine Stelle haben könnte. Der Politiker erhebt sich noch als seinen eigenen Kontrolleur , indem er sich als seinen eigenen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen lässt.
Der Verwaltungschef funktioniert nur nicht wie geplant. Ein defizitäres Krankenhaus muss erst einmal saniert werden. Dazu gehören eine Schwachstellenanalyse, eine Aufdeckung der Rationalisierungsreserven, eine Aktivierung des schöpferischen Potentials der Mitarbeiter und eine Verbesserung des internen und externen Marketings. Wer eine Vision von einem tumorbiologischen Zentrum als Lösung anbietet, muss dringend zum Arzt gehen.
Wer das städtische Krankenhaus retten will, muss einen fähigen Verwaltungschef finden und den ersten Politiker der Stadt vom Krankenhaus fernhalten.
Wir haben einen neuen. Oberbürgermeiser. Wir wünschen ihm ein glückliches Händchen.
Der Begriff des Ehrenamtes ist mir zuerst 1983 nach meiner Migration aus der DDR begegnet. Ich war in einem Dorf bei Elmshorn bei einem Ehepaar untergekommen, er Fernfahrer, sie Lehrerin. „Es gibt drei Ehrenämter, die Du nicht ablehnen kannst, Wahlhelfer, Schöffe oder Freiwilliger Feuerwehrmann“, wurde mir erklärt. Das war für mich nachvollziehbar, war ich es doch gewohnt, sowieso nichts ablehnen zu können.
Über die Jahre habe ich eine Reihe weiterer Ehrenämter kennengelernt, die ich hätte ablehnen können, was ich aber nicht immer getan habe.
Das in Umfragen am häufigsten genannte Motiv freiwilligen Engagements ist das Bedürfnis der Bürger zur gesellschaftlichen Mitgestaltung, wenigstens oder gerade im Kleinen.
Jeder Dritte in Deutschland engagiert sich ehrenamtlich. (2011 ca. 23 Mio)
Das was wir im Kleinen tun, ist die Grundlage des Funktionieren unseres Gemeinwesens. Das zur Rechtfertigung meiner Motivation.
Nachfolgend möchte ich auf mein Ehrenamt als DRK- Kreisverbandsvorsitzender eingehen und auf die besonderen Herausforderungen bei der Motivation von Mitarbeitern im Ehrenamt und in Zusammenarbeit mit bezahlten Angestellten.
Was ich zuerst gelernt habe, war, dass ich alles was ich bisher über Mitarbeiterführung, Motivation … gelernt hatte, vergessen musste. Ehrenamtliche sind anders.
Es fing mit meiner Wahl an. Der Vorsitzende des Kreisverbands wird gewählt von den Ehrenamtlichen. Ich stellte mich im Kreisverband vor. Viele kannten mich von meiner Tätigkeit im Krankenhaus ohnehin. Mein Vorgänger stand aus gesundheitlichen Gründen zur Wiederwahl nicht an. Die Abstimmung ging knapp zu meinen Gunsten aus. Also forschte ich in Gesprächen nach. Viele fühlten sich wegen Erlebnissen der Vergangenheit frustriert und wollten es dem Vorstand jetzt mal zeigen.
Auf was ich mich eingelassen hatte, erkannte ich in aufreibenden Gesprächen mit dem Mandolinenorchester, der Bereitschaft- dem Gros der ehrenamtlichen Mitarbeiter-, dem Jugendrotkreuz, dem Rettungsdienst, den Mitarbeitern von Hausnotruf und Essen auf Rädern, dem Blutspendedienst, dem Suchdienst, den Seniorensportlern, dem Büro und der Geschäftsleitung, der Wasserrettung. Kurz nach Beginn meiner Tätigkeit musste ich beim Präsidenten des Landesverbandes vorsprechen, der mir Glück und eine Reihe von Veränderungen in der Zusammenarbeit wünschte. Dabei erfuhr ich, dass sich mein Geschäftsführer kurzfristig für Rente mit 63 entschieden hatte. Wir mussten unsere bisherige langjährige Sekretärin zur Geschäftsführerin berufen, natürlich unter besonderer Beobachtung des Kreisvorsitzenden.
Unsere Bereitschaft, also die Ehrenamtlichen, die sich um die Verpflegung in Notfallsituationen, die Betreuung von Theater- und sonstigen kulturellen Veranstaltungen kümmert, hatte als Führung eine Doppelspitze. Die weibliche Spitze hatte durchaus spezielle Auffassungen vom Ehrenamt und keine Ambitionen, sich vom Vorsitzenden des Kreisverbands kontrollieren zu lassen. Nachdem sie auch die Abrechnung von Ausgaben und Einnahmen eher sportlich sah- entweder gewinnt sie oder der Vorstand, haben wir uns von ihr getrennt. Als ob das so einfach wäre. Es wurden der Landes- und auch der Bundesvorstand eingeschaltet. Letztlich haben wir uns auf ein Vergleichsverfahren geeinigt und wir waren sie los.
Unglücklicherweise erkrankte die verbliebene männliche Doppelspitze langfristig, sodass eine Stellvertreterlösung greifen musste. Die Dame war sehr engagiert, kam aber mit den kooperierenden Partnern nicht ausreichend klar. Speziell die Kooperation mit der Feuerwehr erwies sich als kompliziert. Auch antichambrieren meinerseits bei der Führungsriege der Feuerwehr, zuletzt unter Moderation eines honorigen Externen führte nicht zum Erfolg.
Letztlich entschloss sich die Bereitschaft zur Ausschreibung von Neuwahlen.
wollte ich noch erzählen.
Wir Medizinstudenten wurden kaserniert.
Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten fanden in Berlin statt. Das Gesindel musste von der Straße weg, also wurden die Aufmüpfigen in Schutzhaft genommen. Wir Medizinstudenten sollten dafür sorgen, dass deren Kinder irgendwie betreut wurden. Bei irgendwem sind wir sie losgeworden.
Natürlich mußten wir uns auch um die allgemeine Gesundheitsversorgung kümmern.
Wir wohnten in Schulen.
Walter Ulbricht war gestorben, das erfuhren wir aber erst hinterher, weil die Spiele nicht gestört werden sollten. Zur Ruhe kamen wir nicht, weil eine Menge Verletzungen zu versorgen waren.
Honecker übernahm strahlend die Macht. Die Weltfestspiele waren ohne Komplikationen gelaufen. Der Sozialismus hatte wieder einmal gesiegt.
Auf das „a“ in ihrem Vornamen legte sie Wert. Sie war 1914 geboren, ihren Vater, einen Schuhmacher aus Wien, hatte sie nie kennengelernt. Er starb im 1. Weltkrieg. Ihre Mutter brachte 5 Kinder zur Welt von drei Vätern. Ihren Stiefvater lernte sie kennen, nicht von der besten Seite. Er war ein begnadeter Trinker und Frauenheld. Wenn er besoffen war, musste sich die Familie auf dem Dachboden verschanzen. Der älteste Bruder hatte immer ein Beil dabei.
Nachdem der Stiefvater in einem Tobsuchtsanfall das Mobiliar aus dem Fenster auf die Straße befördert hatte, wurde er inhaftiert. Dank rührender Liebesbriefe aus dem Gefängnis nahm die Mutter ihn wieder bei sich auf.
Elfrieda hielt das nicht länger aus. Im zarten Alter von 15 Jahren suchte sie sich mit ihrer älteren Schwester Milschi eine Bleibe. Elfrieda hatte eben eine Lehre als Bandweberin begonnen. Der Lehrlingslohn war nicht eben üppig. Die Schwester lernte auch noch. Sie ernährten sich von ranziger Butter, hartem Brot und ab und an einer vergammelten Banane und schliefen in einem kargen Bett.
Die Mutter arbeitete im selben Betrieb als Weberin im Akkord. Oft genug musste Elfrieda die Fäden neu aufheben, wenn sie gerissen waren. Das Augenlicht der Mutter hatte nachgelassen. Der Vorarbeiter schnauzte sie an, wenn er das bemerkte: „ Wir brauchen Rennpferde und keine Samariter“. Milschi heiratete und stand damit auf eigenen Füßen.
Ich habe ein altes Fotoalbum mit winzigen Bildern. Elfrieda auf einer Blumenwiese mit einem schlanken Jüngling, der sie anhimmelt. Es sei alles ganz harmlos gewesen, hat sie mir später erzählt. Ich habe auch keine Ähnlichkeiten mit ihm.
Meinen Vater lernte sie in einer Pension kennen, die die spätere Schwiegermutter betrieb. Sie heirateten 1938, 1939 zog er in den Krieg und kam 1946 als halbe Leiche aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück.
Sie fanden sich über das Rote Kreuz. Sie war in ihrer sudetendeutschen Heimatstadt 1945 interniert gewesen und mit einem Flüchtlingstreck in Landshut gelandet. Über ihre Erlebnisse mit den russischen Treckbegleitern hat sie konsequent geschwiegen.
Das Rote Kreuz hatte ihre Mutter und Milschi in Sachsen ausfindig gemacht. Sie ist dann aus den Westsektoren in den Osten gegangen.
Doch das ist eine andere Geschichte.
obwohl er mir den A. aufreißen wollte.
Nach dem Abitur bekam ich den Einberufungsbefehl. 18 Monate Spreewald. Fliegertechnisches Lager und Transportkompanie in Krugau. Kein Mensch kennt dieses Kaff.
„Sie haben Abitur?“ „Toilette scheuern!“. Feldwebel Stoll hatte seine Vision von einem Soldaten: So wie man sich das in Karikaturen vorstellt. Nur schlimmer, weil es einen selbst betraf.
Die Zahnbürste war bald hin. Ich musste beim Zimmernachbarn klauen. Alle Klischees wurden bedient.
Da ich nicht sichtbar aufmuckte und, wie erwähnt, Abitur hatte, musste ich den MedPunkt übernehmen, also Sanitäter spielen. Der etatmäßige Längerdienende, der dafür bezahlt wurde, war ausgefallen. Wenn man zwölf Jahre zur Schule gegangen war, konnte man auch Pflaster kleben und Tinkturen gegen Fußpilz auftragen.
Was ich nicht gelernt hatte, war, Angehörigen beizubringen, dass ihr Sohn sich mit der Dienstwaffe das Leben genommen hatte. Er war der Kleinste, rothaarig und sehr sensibel. Als wir wegen des Prager Frühlings mit scharfen Handgranaten üben mussten, hatte er es vorgezogen, freiwillig aus dem Leben zu scheiden. Die Augen der Mutter verfolgen mich bis heute.
Nachdem ein „Kämpfer“ bei einer Übung vom Panzer überrollt worden war, habe ich das Amt zurückgeben wollen. Feldwebel Stoll’s Antwort: „Wenn Sie das tun, reiße ich Ihnen…“ Ich bin aus der Nummer nur herausgekommen, weil eine Übung anstand, wo Treibstoff in Plastikbehältern verfüllt und transportiert werden sollte. Das musste fotografisch dokumentiert werden. Da ich Abitur hatte…
Ein Foto machen ist das Eine. Die Abbildung auf Papier kann schwieriger sein. Die Kompanie besaß ein Fotolabor aber keine Anleitung für das Vergrößerungsgerät. Alle Fotos wurden unscharf. Ich schob das auf den schlechten Fotoapparat. Das war zwar nicht falsch, aber auch nicht die richtige Erklärung. Die Übung war wohl erfolgreich, der Kompaniechef aber nicht ganz zufrieden.
Die Tage hörte ich, dass Feldwebel Stoll begraben wurde.
Der Verlobte meiner Urgroßmutter flüchtete 1855 nach Amerika. Unter Mitnahme ihrer Aussteuer.
Meine Großväter habe ich nicht erlebt, der väterlicherseits war Bierbrauer und starb im 1. Weltkrieg. Der Vater meiner Mutter war aus Stockerau bei Wien zugewandert und ebenfalls im 1. Weltkrieg gefallen.
Meine Großmutter musste unter Androhung von Gewalt aus ihrer sudetendeutschen Heimat zusammen mit ihrer jüngsten Tochter nach Sachsen gehen. Laufen wohlgemerkt.
Meiner Mutter wurde nach ihrer Internierung nachdrücklich nahegelegt zu fliehen. Sie landete nach einem Umweg über Bayern auch in Sachsen. Familienzusammenführung.
Mein Vater floh aus russischer Kriegsgefangenschaft. Wurde aber geschnappt. Er landete 1946 letztlich auch in Sachsen.
Wir waren ein typischer Flüchtlingshaushalt mit Oma, zwei Tanten, Vater, Kind in einem Zimmer mit Küche und Trockenklo auf halber Treppe. Da der Vater tagsüber in einer Glasfabrik arbeitete, nachts dort die Öfen heizte und am Wochenende zum Bauern Kartoffeln stoppeln ging, war die Enge erträglich, zumal die Oma im Wald nach Pilzen und Kräutern suchte und die Mutter bei der WISMUT putzte. Das Kind der Tante starb, sie selbst fand ihren Mann wieder und zog nach Augsburg. Dann starb auch die Großmutter. Nach Jahren bekamen wir eine größere Wohnung zugeteilt, wo ich dann ein eigenes Zimmer hatte.
Nach Militärdienst und Studium arbeitete ich an der Berliner Charité, die Mauer täglich fest im Blick. Während des Studiums musste ich noch abends Streife an dieser Mauer laufen, um Flüchtlinge rechtzeitig zu erkennen. Der real existierende Sozialismus mit seiner Indoktrination und der Lehre von der ständig wachsenden Bedeutung der führenden Rolle der Arbeiterklasse brachten mich in arge Gewissensnöte, wo ich doch ständig mit der doppelbödigen Moral der Führungselite konfrontiert war.
Irgendwann nutzte ich eine Gelegenheit zu flüchten. Das war sechs Jahre vor dem Mauerfall. Die bürokratischen Hürden für die Eingliederung waren hoch, nicht zuletzt wegen fehlender Zeugnisse. Schließlich brachte ein Priester unter seiner Soutane meine Approbation in den Westen. Die tschechische Botschaft schickte mir eine Kopie der Geburtsurkunde meines Großvaters, so dass ich nachweisen konnte, dass ich Deutscher bin und arbeiten durfte. Menschlich wurde mir sehr viel Anteilnahme entgegengebracht, ein Oberarztkollege schenkte mir seine Couchgarnitur für meine ansonsten leere Wohnung.
Ähnliche Sympathie erfuhren auch die ersten Übersiedler nach der Öffnung der Mauer. Das hatte sich dann recht bald gegeben.
Nun kümmere ich mich mit dem Roten Kreuz um Flüchtlinge…
Mein Vater stellte Linsen her. Er stand am Glasofen, heizte Glasstücke auf und zirkelte sie mit Manipulatoren auf eine Presse. Sein Kollege gab ihnen mit einem Druck die Form.
Eine dieser Linsen wurde später in meinem ersten Fotoapparat verbaut. Es gab in meinem Geburtsort einen Kleinunternehmer, der Rollfilmkameras 6×6 cm herstellte. Plastikgehäuse, Festblende 8, feste Belichtungszeit 1/50 Sekunde. Bei Sonnenschein gelang jedes Foto.
Zur Jugendweihe wünschte ich mir einen Fotoapparat mit Belichtungsmesser. Mein ganzer Stolz. Hat mir auch noch später bei meiner Promotion geholfen. Ich konnte den Belichtungsmesser zur Ausmessung von Flächen umfunktionieren.
Davor war aber die Dunkelkammer bei der Nationalen Volksarmee. Eine andere Geschichte.
Der Sportplatz in Hainsberg hatte eine Abgrenzung von Zuschauerbereich und Laufbahn durch Balken. Man konnte sich darauf stützen. Ich wurde darauf gesetzt. Mein Vater war ein begeisterter Fußballzuschauer. Manchmal sind wir sogar zu Auswärtsspielen mit dem Bus mitgefahren.
Das Geschehen auf dem Platz wurde intensiv und lautstark analysiert und kommentiert. Vater war emotional so dabei, dass er die erforderlichen Tore- ohne Ball- auf den Zuschauerplätzen mitschoss. Ich hatte immer Mühe, seinen Bewegungen auszuweichen, um nicht von der Stange zu fallen.
Unser Verein war Fortschritt Hainsberg, Wir hatten einen starken Mittelverteidiger, kriegsbedingt einarmig. Seine Einwürfe waren logischerweise regelwidrig, denn Einwürfe müssen beidhändig ausgeführt werden, ansonsten muss der Schiedsrichter pfeifen. Das wurde aber toleriert.
Am meisten regte sich der Vater immer über unseren Torwart auf, der bei jedem Rollball kunstvolle Paraden inszenierte. „Publikumsspieler“. Das Wort fiel oft bei jedem Spiel.
Bei Fortschritt Hainsberg lernte ich auch schwimmen. Die „Fähre“ kriegte ich recht schnell hin und habe dann keine Angst vorm Ertrinken mehr.
Ich wurde dann bei Stahl Freital angemeldet und sollte dort Fußballspielen lernen. Ein paar Mal war ich auch beim Training. Bald wurde uns beigebracht, wie man foul spielt, ohne dass es der Schiedsrichter mitkriegt. Das entsprach nicht meinen Vorstellungen von Sport.
Ich bin dann in die Handballsparte gewechselt. Dort lernte ich, dass am Anfang der Begegnung dem Torwart gezielt ins Gesicht zu schiessen sei, damit er Respekt bekommt. Da ging ich zum Volleyball.
Vater war ein alter Arbeiterturner, also musste ich in den Turnverein, vor allem aber auch, damit ich mein Sportabitur schaffen konnte. Geräteturnen war ein Graus für mich. Ich kriegte meine langen Haxen bei der Hocke am Barren nicht unter dem Körper durch. Den Abschluss des Übungsabends bildete immer ein Korbballspiel, das mich meine missglückten Saltoversuche vergessen ließ.
Nach dem Abitur musste ich zum Militär. Der 10- km- Lauf in Stiefeln ist mir in bleibender Erinnerung.
Im Studium waren 4 Semester Sport Pflicht. Also bin ich wieder beim Fußball gelandet. So ganz viel Spaß hat es nicht gemacht. Aber wenn ich heute Spiele im Fernsehen verfolge, erwische ich mich immer, dass ich die Tore selber schießen möchte, Boguscha geht rechtzeitig in Deckung.

Eine junge Frau sitzt in einem Tatoo- Studio. Ihr Oberarm ist bis zum Ellenbogengelenk mit einem großvolumigen Tatoo verziert. Unterhalb bricht das ab, weil da ein Gipsverband ist.
Das Licht fällt auf den Gipsverband und auf die Hand eines Tätowierers, der das Muster auf dem Gips fortführt. Seine Arme sind von Tatoos übersäht, eigene Haut ist kaum zu sehen.
Die Szene rührt mich an. Wahrscheinlich geht das Tatoo der jungen Frau bis zum Handgelenk, wie zumindest die Skizze auf dem Gips vermuten läßt. Nun aber ist es verdeckt. Wahrscheinlich hat ein Unfall den Unterarm getroffen, Knochen gebrochen. Das dauert.
Vielleicht braucht das Mädchen das Tatoo, um ihre Verletztheit zu verbergen. Oder sie möchte die Verletzung negieren und ein intaktes Leben demonstrieren?
Der Tatoo- Künstler erfüllt ihr den Wunsch. Warum eigentlich? Geld wird er damit nicht viel verdienen. Ein wenig Leidenschaft wird dabei sein, weil er ja selbst ein Tatoo- Begeisterter ist.
Ein paar Fragen, weshalb das Bild es wert ist, angeschaut zu werden.
Meine erste dokumentierte Geschichte stammt aus 1952. Satt waren wir nie. Vater war auf Abbruch, das Stahlwerk meiner Geburtsstadt demontieren. Dafür bekam er die Schwerarbeiterkarte für ein bisschen mehr Kalorien. Aber wir anderen waren auch nicht überernährt. Also musste ich mich anstellen bei der HO, einer staatlichen „Handelsorganisation“ zur Ausgabe für Blutfülle, einem Gemisch von Blut und Roten Rüben- ohne Lebensmittelmarken. Endlich ging die Tür auf. Weit vorne in der Schlange gab es plötzlich Aufruhr. Eine Frau hatte sich vorgedrängelt. Kurze Zeit später erschien die Siegerin mit einer Milchkanne in der einen und einem Haarbüschel in der anderen Hand.
Die Sächsische Zeitung berichtete am nächsten Tag.Ich habe in meinem Leben viel Glück gehabt.
Schon meine Entstehung war ein Glücksfall. Der Vater krank und abgemergelt aus russischer Kriegsgefangenschaft im Salzbergwerk in Sachsen gelandet, die Mutter 1945 interniert und nicht ganz unbeschadet aus dem Sudetenland vertrieben. Das Rote Kreuz hat sie wieder zusammengebracht. Die Flüchtlingsfamilie lebte neben einer Glasfabrik mit 5 Personen in einem Raum. Vater arbeitete tagsüber am Glasofen, sein Hemd steif vom Schweiß, die Brust verbrannt. Nachts ging er die Glasöfen heizen, am Wochenende über Land Kartoffeln stoppeln. Oft genug kam er ohne Rucksack zurück, weil ihn die Polizei abgefangen hatte.
Wo war da die Zeit für die Liebe?
Unsere Großmutter lebte bei uns, mit der ich mir später eine Dachkammer teilte. Unser Atem gefror an der Decke. „Wie wollt Ihr in dieser Zeit Kinder ernähren?“ fragte sie immer wieder. Irgendwie ging es. Meine Eltern wollten, dass ich es einmal besser habe als sie. Irgendwo trieben sie gebrauchte Schulbücher auf. Mit fünf Jahren konnte ich lesen, rechnen und schreiben. Natürlich war das Drill. Aber wahrscheinlich auch die Grundlage für späteres Glück. Ein Geschwisterchen hatte ich mir immer gewünscht, aber auch das Streuen von Zucker auf das Fensterbrett half nicht.
Mein Cousin Willi, sieben Jahre älter als ich, war mein eigentlicher Spielgefährte. Äpfel klauen, wem juckte es da nicht in den Fingern. An der Grundschule gab es Spalierobst, Weizenäpfel. Willi stand Schmiere, ich war am Gerüst hochgeklettert und pflückte. Der letzte Apfel war dem Musiklehrer in die Hand gefallen. Ich ihm später auch. Meine Proteste, ich ginge ja noch gar nicht in die Schule, halfen nichts, ich musste nachsitzen. Ein Jahr später hatte ich ihn als Klassenlehrer. Er konnte sich an nichts erinnern.
Nach acht Jahren Grundschule wurde ich für würdig befunden, zur Oberschule zu gehen, um Abitur zu machen. Ich hatte relativ wenig Schwierigkeiten, den Stoff zu begreifen. Nebenbei mussten wir noch eine Berufsausbildung absolvieren. „Was willst Du werden?“ , fragte der Direktor mich vor über 100 Schülern in der Aula. „Kriminalist“. „Dann kannst Du ja als Beruf nur Krimineller werden“. Die Lacher waren nicht auf meiner Seite. Mein Faible für Kriminalromane ist aber geblieben. Ich wurde also Dreher. Und ich hatte eine Kunstlehrerin, um die mich später alle beneideten, als ich sie geheiratet hatte. Glück gehabt.
Ich war ein freiheitsliebender Typ. Zum 1. Mai wurde Demonstration angeordnet. Damit war meine Toleranzschwelle überschritten. Ich organisierte also einen Streik. Das war in dem System nicht vorgesehen. Eigentlich wollte ich Medizin studieren, also wurde meine Bewerbung an der Universität Jena erst einmal abgelehnt.
„Aufgrund erheblicher Differenzen der von Ihnen gezeigten Leistungen und der Beurteilung durch verschiedene Gremien werden Sie gebeten, vor der erweiterten Zulassungskommission erneut zu erscheinen“. Eine Inquisition von 20 Wissenschaftlern im Kreis stellte überraschende Fragen: „Warum sind Gullideckel rund?“. „Wie würden Sie reagieren, wenn Sie bei einer Geburtstagsfeier angerufen würden, um Hilfe zu leisten?“ . „Würden Sie unter Alkohol fahren, weil alternative Helfer nicht zur Verfügung stünden?“ . „Was würden Sie tun, wenn Sie die Polizei anhielte?“
„Ich würde die Polizisten bitten, mich zu meinem Patienten zu fahren“. Dem wurde nicht widersprochen. Mir wurde ein praktisches Jahr aufgebrummt. Glück gehabt.
Dann kam meine Krankenpflegeausbildung. Stationspfleger Schmieschek sah es als seine Aufgabe an, mich in die elementaren Grundlagen der Krankenpflege einzuweihen. „Enten julen“ war eine Übung, einmal in der Woche die Urinflaschen der Station gründlich zu reinigen. In der Fäkalienabteilung wurde das große Ablaufbecken geflutet. Alle Urinflaschen wurden eingeweicht und dann mit Bürsten händisch gereinigt. Handschuhe anziehen wurde als Schwäche angesehen. Der Geruch ist mir bis heute gegenwärtig. Zur Belohnung gingen wir anschließend auf den Treppenabsatz rauchen.
Die Nachtdienste waren aufregend und einschläfernd. Die Routine war recht schnell erledigt, Kümmeltee ansetzen mit kaltem Wasser. Verbände wechseln und Penizillinspritzen bei den Langliegern. Die jaulten schon, wenn sie mich sahen. Die Kanülen waren stumpf, die Spritzen in den Oberschenkel taten weh und die Mitbewohner in den 20- Betten- Zimmern johlten vor Schadenfreude. Ein Eisenbahner aus der Nachbarschaft wurde wegen Magenkrebs operiert und sollte nach dem Eingriff nüchtern bleiben. Als ich auf meinem Rundgang in sein Zimmer kam, lag er auf dem Boden, mit der halb ausgetrunkenen Blumenvase und regte sich nicht mehr.
Am nächsten Abend beschwerten sich Patientinnen über üble Gerüche auf dem Flur. Ich konnte auch Schleifspuren auf dem Flur entdecken. Sie führten zur Schleuder in unserem Spülraum. Jemand hatte sie mit der Toilette verwechselt. Bei seinem Bettnachbarn meckerte er, dass keine Klosettspülung vorhanden gewesen sei.
Es gab auch Lichtblicke. Einer unserer Langzeitpatienten verlangte nach vier Monaten Koma plötzlich die Zeitung. Er konnte sie auch lesen.
Eine der Schwestern auf der Station hatte mich ins Herz geschlossen. Ich wollte ihr eine Freude machen. Gegenüber vom Krankenhaus wohnte der Ärztliche Direktor in einer tollen Villa mit einer Rosenhecke. Bei der Morgenvisite am nächsten Tag beklagte er sich über die Vandalen, die seine Rosen geplündert hätten. Die Krankenschwester wurde rot. Wir haben beide nichts gesagt.
Dann wurde ich zum Militär einberufen. Das ist aber eine anderen Geschichte.
Meine Exfrau wird in den nächsten Tagen wieder heiraten. Das löst Glücksgefühle bei mir aus.
Die Tatsache nimmt den stillen Vorwurf von mir, ihr Glück zerstört zu haben, der mir allenfalls entgegen kroch. Über 25 Jahre waren wir verheiratet gewesen, nirgendwo hatte ich geklagt. Der Sohn, den sie mit in die Ehe gebracht hatte, wurde von mir adoptiert. Nach unserer Trennung konnte er allerdings mit mir nichts mehr anfangen. Der Enkelsohn hatte mir anfangs noch zwei, drei Briefe geschrieben, war dann aber auch verstummt. Mit der Schwiegertochter hatte ich eh nicht viele Kontakte. Eine Reihe von Freunden wandten sich ab. Mein eingebildet bester Freund, mit dem sie eine Liaison hatte, tauchte ab.
Ich kann ein Kapitel meines Lebens abschließen. Glaubt mir jemand mein Glück?
Rudern für einen guten Zweck
Ich habe mich schon gewundert, als ich ein Ruderboot voller gestandener Männer mit einem Fackelträger am Bug an der Deichbrücke erblickte. Gewohnt war ich die klassischen Boote vom Einer bis zum Achter mit Steuermann in möglichst zierlicher Ausführung. Hier war mehr Power an Bord.
Am nächsten Tag las ich die Erklärung in der Zeitung. Es handelte sich um ein hochseetüchtiges Ruderboot mit einer holländischen Mannschaft, die zusammen mit drei anderen Teams von Den Heldern nach Wilhelmshaven gerudert waren. 70 ehemalige und aktive Marinesoldaten begaben sich zusammen mit Freiwilligen auf eine 351 km lange Tour durch das Wattenmeer. Das Ziel ist, Spenden zu sammeln für die Unterstützung ehemaliger Kameraden, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden.
2015 kamen auf einer ähnlichen Tour bereits über 300.000 € zusammen.
Unter dem Dach der Vereinten Nationen und der NATO hatte das Korps weltweit den Frieden überwacht und Bedürftigen geholfen. Das ging nicht ohne Verletzungen ab. Die offiziellen Hilfsprogramme reichen jedoch nicht aus, um die Traumatisierten zu rehabilitieren.
Die diesjährige Tour war nicht zuletzt wegen der widrigen Wetterverhältnisse wieder eine Herausforderung.
Drücken wir die Daumen, dass wieder ausreichend Spendenwillige erreicht werden konnten.
Ich habe einen Sohn gehabt. Das klingt so wie “ich hatte eine Farm in Afrika…“
Er kam in mein Leben mit einer Frau. Wir gingen durch die Marienkirche in Rostock. Ich erzählte was zur Architektur. Nach ein paar Sätzen fasste er mich bei der Hand. Eigentlich hat er sie 30 Jahre nicht losgelassen. Wir haben zusammen auf dem Gehsteig in Tabarz Karten gespielt und im Wald den reißenden Fischbach verfolgt. Er war dann mit den Detmolder Pfadfindern in Finnland, hatte Einzelunterricht in Russisch, legte ein gutes Abitur hin und studierte in Kiel Medizin.
Nach dem Abitur fuhr er mit seinem Vater in einen Angelurlaub, wollte ihn noch einmal kennenlernen, um sich dann endgültig von ihm zu verabschieden. Bei einer Runde Golf in Oldenburg fragte er mich, ob ich ihn adoptieren wolle. Wollte ich.
Seine zweite Freundin war eine Lehrerin, die unsere Familiengeschichte nicht recht auf die Reihe bekam. Durch unseren Wechsel von Ost nach West hätten wir doch eigentlich profitiert, sagte sie bei einem gemeinsamen Urlaub in Garmisch Partenkirchen.
Auf dem Weg zum Flughafen zu einem Studienaufenthalt nach Amerika erzählte er dann unter Tränen, dass er sich von ihr getrennt habe, weil er ihr nicht zumuten wollte, ein Jahr auf ihn zu warten. Eine Amerikanerin hatte er dann in Boston kennengelernt, die für ihn letztlich nicht in Frage kam, weil sie Apfelsinenhaut hatte.
Nach der Rückkehr lernte er dann im Rahmen der Examensvorbereitung seine Frau kennen. Wir trafen sie in Kiel. Im Seglerheim in Wilhelmshaven machte er ihr in Anwesenheit ihrer Eltern einen Heiratsantrag, die anwesende Kellnerin fasste das als Beschwerde auf und fragte, ob mit dem Nachtisch etwas nicht in Ordnung gewesen sei.
Die Hochzeit fand dann im Schloss von Jever statt. Die Hochzeitsreise ging nach Südafrika. Fancourt war eine genehme Residenz.
Bald kam Carl zur Welt, ein herziger Knirps.
Ich kam vor. Als Opa hatte ich eine Rolle, ein Bedeutung kaum.
Peter hatte eine Stelle in Hannover bei seinem früheren Oberarzt bekommen. Nun musste ein Haus her. In Großburgwedel wurde ein Angebot gefunden. Das Haus musste renoviert werden, aber die jungen Leute hatten Urlaub gebucht. Unser Freund und Baumeister mit Freunden haben das übernommen und mit Wilhelmshavener Handwerkern gelöst. Schön ist es geworden.
Als ich mich von seiner Mutter getrennt habe, hat er unsere Familienbande gelöst
Ich habe meine Meinung gesagt. Selbstzufrieden.
In meinem Duden steht: „auf eine unkritische [leicht selbstgefällige] Weise mit sich und seinen Leistungen zufrieden und ohne Ehrgeiz“ und in einer folgenden Erklärung: überlegen; abgeklärt, gelassen, [selbst]sicher; (gehoben) gleichmütig, souverän; (salopp) cool
Dietmar Neuerer konnte das besser ausdrücken. Er schreibt im Handelsblatt vom 21.9.15:
„Doch für Sloterdijk ist Merkel auch eine „Hohlraumfigur“, in der zahllose Menschen „etwas von ihren Hoffnungen, ihren Ärgernissen, ihren Träumen, ihren Niederlagen, ihren Sorgen, ihren Müdigkeiten“ deponiert hätten, was aber nicht ohne Folgen bleibe. „Der natürliche Preis einer solchen Delegation ist Entpolitisierung“, resümiert Sloterdijk. „Wo Politik war, wird betreutes Dahindämmern.“
An dieser Stelle frage ich mich ernsthaft, ob man den gesunden Menschenverstand an der Garderobe des Parteitagslokales abgeben muss? Ist der äußere Schein einer angeblich hundertprozentigen Zustimmung es wert, seine Glaubwürdigkeit zu riskieren?
Noch eine Bemerkung zu Ihrem „Nachhilfeunterricht in Sachen Demokratie“. Natürlich klingen in meiner Biografie die schlimmen Erfahrungen einer Diktatur nach, allerdings nicht – wie Sie vermuten – in Form von Sehnsucht. Ich erinnere mich noch gut daran, dass Rollkommandos von den Wahllokalen losgeschickt wurden, um Bürger, die um 10:00 noch nicht im Wahllokal erschienen waren, vorzuführen.
Müssen wir jetzt alle jubeln darüber, was Frau Merkel verordnet hat?
Ich tue lieber das, was mir die Menschlichkeit gebietet, vor Ort zu helfen.
Ob aus meiner Meinungsäußerung eine Beleidigung abzulesen ist, mögen andere beurteilen.
Freital ist meine Geburtsstadt. Hier habe ich gelernt. Auch Ingrid kennengelernt. Sie war meine Lehrerin. In Deutsch und Kunstgeschichte. Irgendwann stand ich mit einem Blumenstrauss vor ihrer Tür in einem Einfamilienhaus. Der Besitzer wohnte unten, sie hatte die Mansarde. Ein Quantum Heimlichkeit war auch dabei. Die Gesellschaft war nicht ganz so tolerant wie heute.
Sie hatte eine Beziehung, einen Fotokünstler mit Familie. Aber ich habe gewonnen. Jung, voller Feuer. Kunstinteressiert. Ich hätte meine Ambitionen ausleben können, musste aber erst einmal zum Militär. Lange kein Ausgang, dann Weihnachtsurlaub. Wir landeten in Meißen. Wein aus Keramikbechern. Für die offizielle Feier des Hotels hatte ich keinen Schlips. Konnte ich mir leihen. Meine Eltern warteten vergebens auf den verlorenen Sohn.
Ich habe ihnen dann meine Frau präsentiert. 13 Jahre älter, heiß geliebt. Die rationalen Eltern waren nicht begeistert. Der Vater wurde dann in Gang gesetzt, dem Treiben ein Ende zu setzen. Ohne Erfolg. Wir heirateten und lebten getrennt, sie in Freital; ich in Berlin. Dann kam Anja. Ein Seminarkind. Kinderkrippe, oft genug mußte ich sie aber in den Hörsaal mitnehmen. Die Mädchen schaukelten sie.
Von Ingrid habe ich viel gelernt:
Toleranz- man muss andere Meinungen aushalten können.
Kunstsinn- man muss nicht alles verstehen. Ich kann nicht beurteilen, was Kunst ist, ich kann aber sagen, was mir gefällt- oder auch nicht.
Unübliche Formen des Zusammenlebens, Ehe auf Distanz.
Nach einem Jahr dann der Entscheid. Falls wir uns trennen sollten, käme Anja nach Freital, ansonsten bliebe sie in Berlin. Anja wuchs in Freital auf. Ich konnte Anja oft sehen, auch mit ihr in Skiurlaub fahren. Dann der Grenzübertritt, wir haben uns lange nicht gesehen.
Silvester stand vor der Tür. Frau und Kind hatten sich eben nach Freital abgesetzt.
Ich studierte an der Humboldt- Universität zu Berlin Medizin zu einem Zeitpunkt als gerade Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert wurde. Mein Mentor und späterer Chef war mit der Schauspielerin Barbara Dittus verheiratet, die interessante und nicht immer stromlinienförmige Filme gedreht hatte und im übrigen am Berliner Ensemble, dem Brecht- Theater engagiert war. Sie hatte eben eine Resolution zugunsten Biermanns unterschrieben und war politisch unter Verschiss.
Mein trübsinniger Zustand war aufgefallen, und so wurde ich zur Silvesterparty bei Eckehart Schall und Barbara Berg, der Brecht- Tochter eingeladen. Ich kannte keinen. Nahm aber an. Barbara Berg war eben in den Endproben zu „Turandot oder der Kongress der Weißwäscher“, natürlich von Brecht.
Irgendetwas wollte ich als Geschenk mitnehmen. Also goss ich eine Münze mit der Turandot. Ob sie gelungen war, weiß ich nicht. Habe später davon nichts mehr gehört. Ich klingelte an der Wohnungstür in der Friedrichstraße. Zwei Kinder öffneten, ich konnte mein Gastgeschenk loswerden und gleichzeitig die Hausfrau identifizieren, indem ich die beiden bat, das Geschenk der Mama zu übergeben. Ich stellte mich artig vor und wurde unkompliziert aufgenommen.
Beim Umschauen im Raum war das dann nicht mehr so einfach, denn auf dem zentralen Sofa saß eine junge Dame nahezu oben ohne mit einer schwarzen hochdurchsichtigen Bluse. Später erfuhr ich, dass das die ständige Begleiterin von Eckehart Schall war.
Im Laufe des Abends kamen noch eine Menge Leute dazu, Manfred Krug, Armin Müller- Stahl mit seiner Frau, die meine Kommilitonin war, und irgendwann Renate Reinecke, Schauspielerin am Maxim- Gorki- Theater. Blaue Augen, blonde Mähne und gesprächig. Ich erinnere mich an eine lockere Atmosphäre mit viel Jux. Später hörte ich dann: „ Der Raab hat den ganzen Abend nur Bier getrunken und mit der Reinecke gequatscht“. Das stimmte wohl, vor allem weil es Dosenbier aus dem Westen war.
Ein paar Tage später traf ich sie dann zufällig wieder an der Charité gegenüber des Künstlerclubs „Möwe“. Sie winkte mir über die Straße in Lammfellmantel und Schapka zu. Das Schicksal nahm seinen Lauf.
Sie hatte eine Mansardenwohnung in Biesdorf. Da bin ich irgendwann mit eingezogen. Wenn Regisseure zu Besuch kamen, habe ich mich aus dem Staub gemacht.
Letztlich haben wir mit Hilfe von Frank Mielke eine Neubauwohnung an der Warschauer Straße bekommen.
Dann haben wir auch geheiratet. So ganz einfach war das Zusammenleben nicht. Ich war tagsüber mit Studium und Arbeit beschäftigt. Wenn ich nach Hause kam, ging sie zur Vorstellung. Öfter haben wir dann im Theatercasino nach der Vorstellung einen Absacker getrunken. Bei diesen Gelegenheiten habe ich viele interessante Schauspieler kennengelernt, Biewer, der nur Wodka trank, weil er Diabetes hatte, Junker, der eine Bescheinigung hatte, trotz Alkohol Auto fahren zu dürfen. Uwe Kockisch sollte zum Militär, ihm habe ich dann einen M. Scheuermann angedichtet, er wurde wehruntauglich und später weltbekannt.
Öfter rief das Theater dann an, die Reinicke sei auf der Bühne zusammengebrochen, Ich solle sie abholen.
Irgendwann war Nikolaus unterwegs. Das schien ein neuer Anfang zu werden.
Das ist aber eine andere Geschichte.
Gut erinnere ich mich an unser gemeinsames Distelstechen.
Meine Großmutter war schon etwas von der Zeit gezeichnet. Obwohl klein von Wuchs, trug sie das Schicksal mit gebeugtem Rücken.
Unser Kaninchen hatte seinen Verschlag im Kohleschuppen. Es musste sich gegen die Ratten durchsetzen, die hinter dem Brikettverschlag ihre Behausung hatten. Wenn wir Disteln fütterten, blühte das Tier auf.
Also erbat sich Großmutter abgelegte Arbeitshandschuhe von meiner Mutter, die sie mit Papier verstärkte, und wir zogen los. Am Weißeritzbach in der Nähe des Waldrandes gab es die fettesten Disteln. Wir brauchten nicht lange, und unsere Einkaufstasche war voll. Großmutter wollte noch ein paar Beeren sammeln, aber ich drängte nach Hause.
Ich wollte das Schnurpsen hören, wenn das Kaninchen die Disteln knabberte.
Immer kurz vor Weihnachten war das Kaninchen verschwunden. Ausgebüxt, wie meine Großmutter sagte.
Am Heiligabend gab es traditionell Kaninchen. Wir falteten die Hände zum Tischgebet „und segne, was Du uns bescheret hast“ . Irgendwie musste ich dann immer an das Distelstechen denken.
Sterben kann man nicht lernen.
Es ist immer das erste Mal- und das letzte. Es ist unvermeidlich. Und es gibt keinen, der über sein Erleben des Sterbens berichten kann.
Viele haben versucht, sich dem Thema zu nähern- durch die Analyse von Nahtoderlebnissen, die Aufzeichnung von Äußerungen von Sterbenden, so Sokrates nach dem Trunk des Schierlingsbechers.
Der Satz von Goethe ist überliefert: „mehr Licht“. Manche zweifeln am Inhalt, er habe wohl sagen wollen, dass man so „ schlecht liegt“.
Die Glaubensgemeinschaften haben ihre Sicht auf das Mysterium des Todes.
Manche betrachten das Erdendasein als Zwischenzeit bis zum ewigen Leben oder bis zur Wiedergeburt.
Fanatiker sprechen vom Helden- oder Märtyrertod. Mediziner kämpfen gegen den Tod und müssen sich oft genug geschlagen geben.
Allen ist gemeinsam- wir wissen nichts über den Tod.
Aber müssen wir immer alles wissen?
Sollten wir uns nicht einfach über das Wunder des Lebens freuen und akzeptieren, dass alles endlich ist?
Ich hatte einen Freund. Der verstand was von Computern. Im Hauptamt war er Lagerist- Logistiker würde man heute sagen. Er war der Erfinder der chaotischen Lagerhaltung. Das Problem war, wenn er im Urlaub war, konnte man nichts mehr finden, da sein System keiner verstand.
Er hat alle meine Computer repariert. Und er konnte „die müdeste Möhre“ wenigstens zum schnellen Spaziergang überreden.
Wenn ich den Computer von ihm abholte, konnte ich meinen Freund vor lauter Qualm kaum im Zimmer entdecken. Er war der große Raucher, und das war auch sein Schicksal.
Als ich ihn auf der Krebsstation besuchen wollte, brannte auf seinem Nachttisch eine Kerze. Er lag ganz friedlich in seinem Bett. Die Nase blass, die Hände auf der Bettdecke gefaltet.
Eine Ordensschwester unterbrach ihr Gebet und forderte mich zum Hinsetzen auf. Es war eine unwirkliche Situation. Gestern hatte er mir noch von seiner Chemo berichtet und mir ein Bild von seiner Glatze geschickt, auf die er mit Filzstift ein paar Haare gemalt hatte.
Ich muss wohl ziemlich fassungslos ausgesehen haben und wusste auch nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. Die Ordensschwester sagte mir: „Streicheln Sie ihn doch noch einmal“.
Die Geste hat mir geholfen und hat mir auch klar gemacht, dass der Tod dem, der gelebt hat, aber auch den Hinterbliebenen gehört.
Ich erinnere mich genau. An den Flug. Es war eine Antonov, die jedes Luftloch mitnahm. Mueller- Stahl schreibt in seinem Buch „Dreimal Deutschland und zurück“ :
„Gabi (seine Frau) … hatte … eine Ausbildung zur Elektromechanikerin absolviert und war zum Medizinstudium zugelassen worden- übrigens in einem Semester mit dem Sohn des Stasi- Ministers Erich Mielke. Gemeinsam reisten die beiden mit Kommilitonen nach Moskau und Ungarn, was für Gabi aufregend und neu war. Das waren keine politischen Delegationen, sondern touristische Reisen, die durch Mielkes Sohn möglich waren.“
Ich saß im gleichen Flugzeug. In der Erinnerung wird manches blass. Soviel weiß ich aber noch, dass der Anlass der Reise der 150. Geburtstag von Lenin war und wir im Hotel Ukraina, in einem Spitzenhotel in der Gorkistraße unterkamen. Nach durchfeierter Nacht (Schampanskoje war für unsere Verhältnisse sehr preiswert) erwog die örtliche Komsomolorganisation, von uns ein Geschenk anzunehmen, um die Ärgernisse dieser Nacht zu vergessen.
Auch sonst ist nicht viel im Gedächtnis geblieben- bis auf den Jungfrauenfriedhof, wo Chruschtschow begraben liegt. Sein Grabmal zierte ein Monument aus weißem und schwarzen Marmor, das seine Ambivalenz zum Ausdruck bringen sollte.
Auf der Rückfahrt zum Hotel sahen wir noch, wie ein Taxi einen Hund überfuhr. Keiner stieg aus. Noch im Rückfenster konnte man sehen, dass von ihm nicht viel übrig geblieben war.
Der Rückflug verlief sehr einsilbig. Ob es an dem Schampanskoje oder dem Hund lag?
In der Grundschule hatte ich einen Freund, der wunderbar zeichnen konnte. Er war sehr beliebt. Die Helden unserer Kindheit aus den Karl- May- Büchern zauberte er mit dem Bleistift aufs Papier. Später wünschten wir uns Nackte- das Internet war noch nicht erfunden. An die Bilder erinnere ich mich nicht.
Mein Großvater war Buchdrucker und hatte hinreißende Inkunabeln hinterlassen. Das spornte mich an. In meiner Geburtsstadt existierte ein Zeichenzirkel, der von einem prominenten Künstler, Professor Bammes, geleitet wurde. Mein Freund Wolfgang nahm mich mit dahin. Wir sollten eine Distel zeichnen. Meine war zu zahm. Also ließ ich mein Talent eine Weile schlummern.
Während des Studiums mussten wir mikroskopische Präparate zeichnen. Das regte mich wieder zum Gestalten an. Zu dieser Zeit gab es im Prenzlauer Berg eine alternative Kunstszene wo auch mein Chemieseminarbetreuer malte. Er nahm mich mit. Da entstanden mit pastöser Farbe dreidimensionale Bilder. Ich erinnere mich an einen überfahrenen Hund in der Gorkistraße in Moskau, den meine Mentoren bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten demonstrierten. Der Zirkel war nicht systemkonform und wurde aufgelöst.
Meine Frau war Kunstlehrerin. Es gab einen Zeichenwettbewerb in meiner Geburtsstadt. Ich reichte eine Federzeichnung „Schwester Monika“ ein. Voller Erfolg, die Frau war weg. Schwester Monika auch.
Danach verlegte ich mich aufs Fotografieren. Mache ich immer noch.
Milschi war die älteste Schwester meiner Mutter. Eigentlich hieß sie Emilie. Aber die Sudetendeutschen liebten die Verkleinerungsformen. Milschi war Bandweberin. Eines von 5 Kindern der Großmutter. Der Stiefvater war Trinker und gewalttätig. Er zertrümmerte ab und an das Mobiliar, und die Familie mußte sich auf dem Dachboden in Sicherheit bringen.
Einmal verständigte der Älteste die Gendarmerie. Die holte den Stiefvater ab.
Die Großmutter besuchte ihn im Arrest. Er bettelte, sie möge ihn rausholen. Natürlich wolle er sich ändern. Die Großmutter glaubte ihm. Das Elend ging wieder von vorn los.
Milschi und meine Mutter hielten das nicht mehr aus. Sie gingen weg von zu Hause, Mutter war 14, Milschi 25. Beide arbeiteten in der Weberei für einen Hungerlohn. Sie hatten sich eine Schlafstelle gemietet. Zum Essen reichte es kaum. Sie kauften sich ranzige Butter und altes Brot, um zu überleben. Über den Tag begegneten sie ihrer Mutter im Betrieb und konnten ihr helfen, wenn die Kettenden rissen und ihr das Auffinden der feinen Fäden nicht mehr recht gelang.
Dann lernte sie Rudolf kennen, ihren Traummann. Die Hochzeit folgte bald. Und bald folgte die Einberufung. Rudi kam an die Westfront und nicht so schnell wieder nach Hause. Bei einem Fronturlaub entstand die gemeinsame Tochter. Die musste auf der Flucht 1945 manches mitmachen. Die Großmutter wurde mit Milschi und der jüngsten Tochter nach Sachsen deportiert.
Rudi kam in amerikanische Kriegsgefangenschaft und wurde 1946 nach Augsburg entlassen. Die gemeinsame Tochter hatte die Strapazen nicht überlebt. Sie wurde ein Jahr alt. Wir haben ihr Grab lange gepflegt.
Rudi fand eine Anstellung bei der Schwäbischen Landesregierung und holte Milschi zu sich nach Augsburg.
Zu der Zeit streifte ich mit meiner Großmutter durch die sächsischen Wälder. Sie war eine Überlebenskünstlerin. Wir sammelten Kräuter und Fichtenspross. Das sind die jungen Triebe der Fichten. Sie wurden dann in Alkohol eingelegt und waren ein vorzügliches Hustenmittel. Wenn die Heide blühte, streiften wir die Halme ab, das ergab einen feinen Tee. Und wenn die Bucheckern abfielen, konnte man man mit ihnen einen tollen Kuchen backen.
Alle die Köstlichkeiten wurden dann auch in den Westen nach Augsburg geschickt. Milschi revanchierte sich mit Palmin und Schokolade.
1956 konnte ich dann mit meiner Mutter nach Augsburg fahren. Das ging damals noch.
Rudi zeigte uns die Fuggersiedlung und den Lechkanal. Bei einem Spaziergang kamen wir an einem Tennisplatz vorbei. Ein Ball war im Zaun hängengeblieben. Onkel Rudi holte mir ihn als Trophäe. Ich habe ihn bis zu meinem letzten Umzug noch aufgehoben. Er mochte mich wohl. Bei einem Besuch bei uns in Hainsberg schenkte er mir ein Spielzeug, das einen Propeller abschoss, wenn man an einem Seit zog. Das funktioniert gut. Nur lag unser Garten an einem Flussufer, Der Propeller landete im Wasser. Onkel Rudi im Schlips und Anzug hinterher. Der Abend war gelaufen.
Auch sonst war Onkel Rudi nicht sehr angepasst. Er hatte eine neue Liebe entdeckt und eine neue Tochter bekommen. Zu der wollte er sich bekennen und die Mutter heiraten. Milschi liess sich aber nicht scheiden. So ging Rudi mit dem Kinderwagen als Staatsbeamter durch Augsburg. Skandal!
Leider ist er relativ früh verstorben. An seiner Beerdigung konnten wir dann nicht mehr teilnehmen. Die politischen Verhältnisse hatten sich verändert.
Milschi hat uns dann noch oft in Hainsberg besucht, der Urlaub war für sie ja preiswert.
Sie war knauserig, aber nicht zu mir. Mein erster Computer war ein TI 99 von Texas Instruments, der mir bei der Wissenschaft sehr geholfen hat. Meine Forschungsreisen in den Westen hat sie immer bezuschusst. Peinlich war mir das schon manchmal. Ich war aus Berlin ausgereist mit 50 Westmark als Überlebenshilfe mit der Aussicht, dass der Gastgeber die Kosten übernimmt. Mein Geld war ja im Westen nichts wert. Dann kam ich in London an, fuhr mit dem Flughafenbus in die Innenstadt und flüchtete gleich wieder in den Bus, weil ich das Hotel nicht bezahlen konnte- Der Gastgeber wusste nichts davon, dass er bezahlen sollte. Mein Anruf bei Milschi rettete mich.
Irgendwann lernte sie Ludwig kennen. Einen einfältigen Bayern, der sie aber willig begleitete- auch zu ihrem Bruder nach Südafrika. Es gibt viele schöne Fotos davon.
Ludwig starb später an einem Darmtumor.
Kurz darauf erhielt ich einen Anruf, dass sie in der Arztpraxis einen Insult erlitten habe. Wie man weiter verfahren solle. Wir haben entschieden, dass man der Natur ihren Lauf lassen solle.
Dann musste ich die Beerdigung organisieren, die Wohnung kündigen und entrümpeln.
Ich habe sie dann neben Rudi begraben.
Wer kennt Niedersachswerfen?
Wer hat mal spätabends versucht, mit dem Bus aus Niedersachswerfen wegzukommen?
Wir vor 47 Jahren.
Zwei Kommilitonen und ich wollten einen Freund besuchen und hatten die Vorstellung, wir müssten ihn finden können. Immerhin ist der Ort übersichtlich. Nachdem wir fast alle Bewohner befragt hatten, war es spät geworden. Unser Freund war da nicht bekannt. Gutes oder schlechtes Zeichen? Egal. Nun wollten wir aber wieder weg. Was wir nicht bedacht hatten, inzwischen war der Winterfahrplan in Kraft . Also kamen wir nicht mehr weg.
Ein Gasthaus gab es nicht. Eine Telefonzelle auch nicht. Aber ein Nottelefon war in einem Haus per Schild verfügbar. Das Schild war wohl auch schon etwas älter. Ein Telefon gab es dort nicht mehr.
Ist schon einmal jemand von Niedersachswerfen nach Nordhausen in der Dunkelheit per Anhalter unterwegs gewesen?
Wir vor 47 Jahren.
Inzwischen hatte es angefangen zu nieseln. Das erhöhte unsere Chancen zum Mitgenommenwerden nicht unbedingt. Wir schickten unsere Kommilitonin vor. Ihrem Daumen konnte ein Trabifahrer nicht widerstehen. Nachdem wir auch noch aus dem Gebüsch aufgetaucht waren, murmelte er nur, er wolle sich doch seine Sitze nicht ruinieren und fuhr davon.
Kennt jemand den Zustand, vollständig durchnässt zu sein? Vergessen von der Welt. Ich erinnere mich nach 47 Jahren noch sehr lebhaft daran.
Als wir schon völlig demoralisiert dem Glauben und der sozialistischen Grundordnung abgeschworen hatten, hielt plötzlich ein schwedischer Laster neben uns. Wir sollten einsteigen. Weiß jemand, wie schwierig es ist, in einer solchen Situation die Hilfe des Klassenfeindes abzulehnen?
Wir stiegen ein. Der Fahrer drehte die Heizung hoch, dass unsere Klamotten trocknen sollten.
Plötzlich musste er bremsen. Der Volkspolizist mit der Kelle belehrte ihn, dass er auf der Transitstrecke keine Personen aufnehmen dürfe. Wir hatten Zeit auf der anderen Seite aus dem Fahrerhaus zu rutschen.
Wir liefen weiter, die Unterhosen waren sowieso noch nicht trocken. Schlimmer konnte es nicht werden.
Kann sich jemand noch an die langen Spaziergänge mit der ersten Freundin erinnern? Ich bot alle meine Überredungskünste auf, um einen Kuss zu erhaschen, täuschte Traumata in der Kindheit vor, um Mitleid zu erregen. Vergebens.
Meine Angebete lebte auf dem Dorf. Über zwanzig Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Bergiges Gelände. Bus fuhr nur einmal am Tag- wochentags.
Ilka war auch noch meine Tanzstundenpartnerin. Der Ball stand an. Ich zwängte mich in meinen Jugendweiheanzug, erstand einen Chrysanthemenstrauß und klopfte bei Ihren Eltern an. Alle Benimmregeln hatte ich gelernt- nicht zum Essen bleiben… Aber es fuhr kein Bus mehr.
Es waren ganz nette Gespräche. Schließlich bot mir die Großmutter noch ihr Fahrrad an, damit ich nach Hause fahren konnte.
Ilka ist dann aus meiner Umgebung verschwunden.
Mein Tanzstundenlehrer hat sich aber an mich erinnert. „Wir haben Frauenüberschuss und brauchen Männer!“ Ganz ist die Ansprache nicht an mir vorbeigegangen. Den Blumenstrauß bezahlt natürlich die Tanzschule.
Überredet. Zur letzten Tanzstunde wurde ich dann eingeladen. Die mir zugedachte Tanzpartnerin war wahrlich keine Schönheit im herkömmlichen Sinn. Wir konnten uns auch schwer unterhalten.
Meine Körpergröße führte dazu, dass wir die Polonäse anführen mussten. Ich habe gelitten.
Das Ritual erforderte, dass man den Eltern der Dame vorgestellt wurde, Sie kamen an unseren Tisch. Die Mutter musterte mich kritisch, befand dann,“ es geht“.
Ich habe keine der Beteiligten später wieder getroffen
